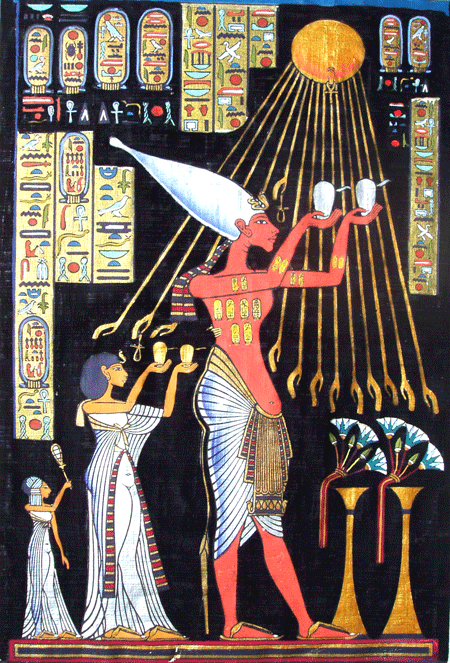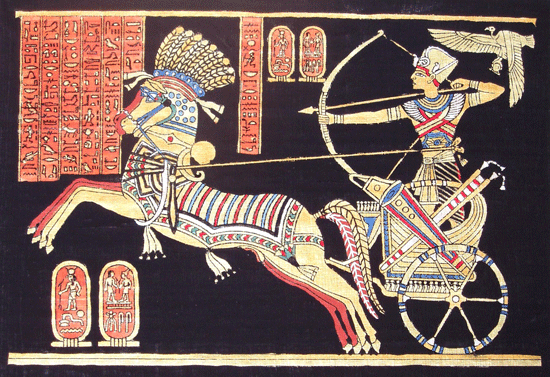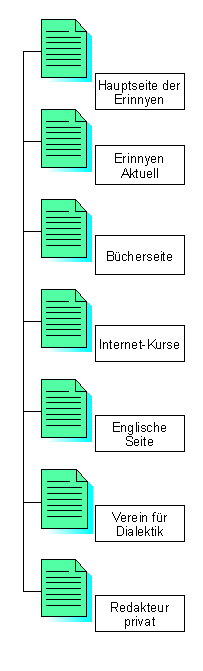|

   

| |
Bodo
Gaßmann
Moral
und Herrschaft
Die
Entstehung der Moral am Beispiel des Dekalogs
Inhalt
- Die
Sitte in der Gentilgesellschaft
- Die
altisraelitische Gesellschaft und die Moral der Weisheit
- Die
Moral des Dekalogs
- Die
Gebote im Einzelnen: Das 1. Gebot / Das
2. Gebot / Das 3. Gebot / Das
4. Gebot / Das 5. Gebot / Das
6. Gebot / Das 7. Gebot / Das
8. Gebot / Das 9. Gebot / Das
10. Gebot
- Aporien
der Moral des Dekalogs
Anmerkungen
/ Literaturliste
Moral ist eine historisch späte Erscheinung im
Zusammenleben der Menschen. Dem scheint die anthropologische Tatsache zu
widersprechen, nach welcher der Mensch nicht durch seine (rudimentären)
Instinkte in der Natur überlebt, sondern durch seinen mehr oder weniger
entwickelten Verstand, weshalb er seine Beziehungen durch Kultur und nicht durch
biologische Schemata reguliert. Er müsste demnach, seit er das Tierreich
verlassen hat, Moral besitzen. Dies ist jedoch falsch. Zwar lassen sich mittels
Sprache tradierte Verhaltensweisen in frühen Kulturen nachweisen bzw. haben in
ungleichzeitigen primitiven Gesellschaften bis ins 20. Jahrhundert überlebt,
aber solche Verhaltensmuster, die sprachlich benannt werden, sind noch keine
Moral, die als Sollen einer Wirklichkeit, die dem Sollen nicht immer entspricht
- denn sonst brauchte man keine Gebote als ‚Sollen’ -, entgegengesetzt
werden müssen und die mit einem gewissen Zwang verbunden gedacht werden, um sie
durchzusetzen. Die etymologische Entstehung der Begriffe ‚Ethik’ und
‚Moral’ ist ein Indiz für die Neuartigkeit dessen, was wir unter Moral seit
der Antike verstehen. Beide Begriffe bezeichnen ursprünglich die Sitte, dann
den Gegenstand, auf den sich die philosophische Reflexion bezieht. Erst seit
Cicero setzt sich allmählich die Bedeutung von Moral durch, die
Verhaltensnormen ausdrückt, die in die soziale Wirklichkeit regulierend
eingreifen sollen. (1) Aus ‚Ethos’ hatte allerdings schon Aristoteles den
Ausdruck ‚Ethik’ abgeleitet, der entsprechend seinem Werktitel die
Reflexion von Moral und Sitte, also deren Wissenschaft bezeichnet. Um das
Neuartige an der sich herausbildenden Moral zu verstehen, muss das Wissen um den
vorhergehenden Zustand vorausgesetzt werden, denn nur in Bezug auf einen Zustand
ohne Moral offenbart sich die differentia specifica dessen, was Moral von naturwüchsiger
Sitte unterscheidet. Die Menschen der Urgesellschaft hatten ein magisches
Bewusstsein. Ihre inneren Vermögen waren für sie etwas Fremdes, ihre Psyche
erschien ihnen von unbekannten Kräften beherrscht. Ihr Bewusstsein, von dem sie
noch keinen Begriff hatten, erlebten sie als Schauplatz willkürlicher und
unheimlicher Gewalten. Die Natur, die sie nur so weit beherrschten, um überleben
zu können, versuchten sie mittels Zauber, in dem nur die Intention realistisch
war, zu bannen. Sie hatten weder eine klare Vorstellung von sich als Art noch
ein mit sich identisches Bewusstsein. Zwischen Subjekt und Objekt gab es
dementsprechend keine deutlichen Unterscheidungen. Selbst in den Homerische Epen
ist noch kein identisches Ich-Bewusstsein vorhanden, auch wenn im
Unterschied zum magischen Bewusstsein die menschlichen Kräfte durch eine überschaubare
Götterwelt symbolisiert wurden, was sich allerdings erst mit dem heutigen
Wissen erschließen lässt. Das heißt, es fehlte ein rationales
Selbstbewusstsein, dieses war nur als magisches und religiöses, aber gerade
deshalb fremdes und undurchschaubares vorhanden. Dennoch musste schon das Verhältnis
der Menschen in der frühen Gentilgesellschaft eine gewisse Ratio haben, denn
sonst hätte sie nicht überlebt. Da dieses Verhältnis nicht biologisch
vorgegeben war, musste es aus ihrer kulturellen Tradition hervorgehen. Diesen
Zustand will ich im Gegensatz zu instinktiven Verhaltensmustern als einen der
Sitte bezeichnen. So fanden sich bei den Tasmaniern, die noch in einer
Gentilordnung lebten, folgende Begriffe, die sich auf das gegenseitige Verhalten
beziehen:
der Gutmütige
-
Paegrana
der Heitere
-
binana
der Zänkische
-
njundjana
der Schamlose
-
valabjurena (2).
Diese Begriffe, die das Verhalten zur Sippe und zu den
anderen Mitgliedern der Gemeinschaft werten, sind noch ganz an die Person
gebunden. Ihre Substantivierung in der Übersetzung darf nicht als Typisierung
dieser Individuen aufgefasst werden, sondern sie benennt eine Eigenschaft der
Einzelnen, neben der unverbunden andere stehen können. Dennoch werden hier
nicht biologische Eigenschaften bezeichnet, sondern sittliche. Aus derartigen
Charakterisierungen von Personen sind dann wahrscheinlich abstrakte
Bezeichnungen für sittenwidriges und sittengerechtes Verhalten geworden, wie
z.B. das Wort Lüge (kaitina)(2) bei den Tasmaniern. Begriffe wie ‚Lüge’
sind aber noch weit entfernt von einem expliziten Gebot: „Du sollst nicht Lügen“,
das theologisch abgesichert und im Gottesdienst verlesen werden muss, um ständig
daran zu erinnern, dass die Lüge (vor allem vor Gericht) eingeschränkt werden
muss, soll der Zusammenhalt der Gesellschaft erhalten bleiben. Im Gegensatz zu
solchen Sollensforderungen ist die Sitte noch naturwüchsig, Resultat nur
teilweise bewusster Lebensverhältnisse, nicht das Produkt einer intellektuellen
Reflexion. Unter Sitte verstehe ich die
naturwüchsigen Gebräuche, Verhaltensmuster und Bewertungskriterien, welche
die sozialen Beziehungen der Menschen regeln und die zur Gewohnheit geronnen,
also habituell sind, so dass sie durch die Sozialisation den Nachkommen tradiert
werden. Die Sitte ist Produkt der Kultur und insofern nicht mehr erste, sondern
zweite Natur. Soweit diese den Mitgliedern der Gentilgemeinschaft bewusst
oder halb bewusst ist, wird sie durch die Alten mit lebensgeschichtlich
akkumulierter Erfahrung in Riten, Mythen und magischen Bräuchen tradiert. Dass
es sehr früh in der Menschheitsgeschichte bereits Begriffe für sittliches und
sittenwidriges Verhalten gab, während andererseits z.B. handwerkliche
Verfahrensweisen durch Nachahmen tradiert und teilweise erst Ende des 18.
Jahrhundert begrifflich gefasst wurden, deutet darauf hin, dass die sozialen
Beziehungen und ihre Organisation ein entscheidender Vorteil im Überlebenskampf
in der Natur waren.(3) In der Gentilgesellschaft fehlen Moralvorschriften und
moralische Belehrungen wie andererseits die religiösen Vorstellungen noch nicht
sittliche Gebräuche absichern, sondern neben diesen stehen. Das hat seinen
Grund ebenfalls darin, dass es noch keine Moral im Sinne von Vorschriften,
Normen und Geboten gab, die extra gegen eine nicht immer ihnen entsprechende
Verhaltensweise abgesichert werden musste. Die Sitte war gelebte Sitte, wer
gegen sie verstieß, wurde aus dem Gentilverband ausgeschlossen und verlor
dadurch seine physische Existenz. Ein solcher Verstoß war den anderen unerklärlich,
wurde wohl als Krankheit interpretiert, denn es gab keinen Grund, gegen die
Sitte zu verstoßen, weil es keinen Vorteil brachte. Im täglichen Überlebenskampf
der Gens gab es noch keine Voraussetzung dafür, dass sich Einzelne auf das
Denken, etwa als Priester, spezialisierten, denn diese Urgesellschaften produzierten nur so viel, dass sie überleben konnten. Der Einzelne war Teil des
Kollektivs, und nur im Kollektiv konnte er überleben. „Besonders deutlich
trat der kollektive Charakter der Produktion und der urgemeinschaftliche
Kollektivismus überhaupt bei der Verteilung der Produkte der Arbeit für die
Konsumtion hervor. Nach Ch. Mountford genoss bei den Ureinwohnern Australiens
der erfolgreiche Jäger in seinem Stamm keinerlei Vorrechte beim Aufteilen oder
Verteilen der Beute. Einziger Lohn des Jägers war das Erfolgserlebnis der Jagd
selbst und das Lob seiner Stammesmitglieder.« (4)
Das Leben nach dem Prinzip: „Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach
seinen Bedürfnissen“, das zwanglose Verhalten untereinander nach
hergebrachter Sitte, das also, was uns heute als utopisches Moment einer
Urgesellschaft erscheint (die andererseits den Launen der Natur unbarmherzig
ausgeliefert war und auf primitivem materiellen Niveau dahinvegetierte), war
zugleich der große Mangel dieser Kultur. Änderten sich die Umstände, musste
die Sitte deshalb geändert werden, dann war dies nur unter großen Konflikten möglich.
Denn diese Gesellschaften hatten kein Instrumentarium, um mit Änderungen der
Lebensbedingungen anders als durch Gewalt fertig zu werden, wozu je nach
Situation auch Menschenopfer, innerer Krieg und das Zerbrechen der Gens, also
ihr gemeinsamer Untergang gehörten. „Diese naturwüchsigen Gemeinwesen, an
deren Nabelschnur jeder Einzelnen hing (Marx), sind nicht zu verklären und
nicht in reaktionärer Romantik von der Einfachheit, Natürlichkeit und
Kindlichkeit des Lebens als Ideal zu propagieren. Neben den Gemeinschaftsgeist
existierten zutiefst negative Sitten: Stammesbeschränktheit, Rachsucht,
Grausamkeit, blinde Ergebenheit gegenüber eingebürgerten Bräuchen, tiefer,
selbstgefälliger Obskurantismus (die ‚bodenlose Unwissenheit des Wilden’)
durchdrungen von Mystik, Magie und Religion.“(5)
Der blinden Kollektivität entsprechend waren individuelle Entscheidungen
- ein Kennzeichen der Moral - bedeutungslos.
Wenn die gewöhnliche sittliche Leistung der Einzelnen in der
Unterordnung unter die bestehenden Gebräuche liegt, dann werden Neuerungen und
Initiativen unterdrückt.
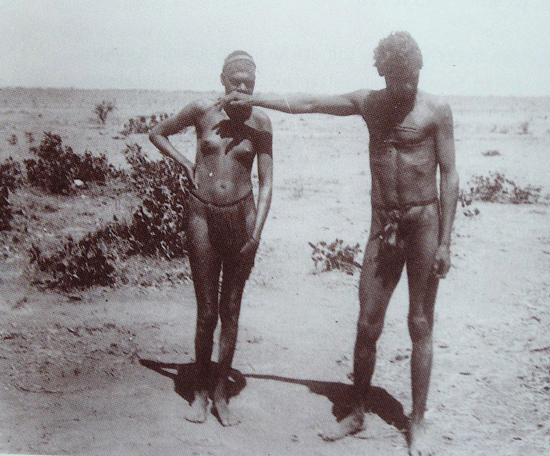
Die Witwe eines Aborigines darf nach dessen Tod nicht
reden, erst nach einer etwa einjährigen Trauerzeit wird der Bann von ihr
gelöst, indem sie einen Verwandten ihres verstorbenen Mannes in die Hand
beißt.
Solche Neuerungen wurden aber in dem historischen
Moment notwendig, als es den Menschen der Urzeit gelang, das materielle Niveau
derart zu steigern, dass sie ein Mehrprodukt produzieren konnten, d.h. ein Produkt, das über die einfache Reproduktion hinausging,
also einen Fortschritt ermöglichte. Durch die Produktion von Lebensmitteln über
die Befriedigung der notwendigen Bedürfnisse hinaus wird es möglich, dass sich
einige dieses Mehrprodukt aneignen. Es wird Herrschaft möglich, d.i. die
kostenlose Aneignung fremder Arbeit bzw. der Resultate dieser Arbeit. In fast
allen Gesellschaften, die dieses Stadium der Entwicklung erreicht haben, hat
sich eine Herrschaft etabliert. Dadurch, dass die Herrschenden Muße haben, d.h.
freie Zeit, die sie nicht für die eigene Reproduktion aufbringen müssen, haben
sie auch Zeit, sich mit Wissenschaft zu befassen. Was Aristoteles über die
Mathematik sagt, gilt mehr oder weniger auch für die Moralwissenschaft: „Bei
dem Fortschritt in der Erfindung von Künsten, teils für die notwendigen
Bedürfnisse,
teils für die (angenehmere) Lebensführung, halten wir die letzteren immer für
weiser als die ersteren, weil ihr Wissen nicht auf den Nutzen gerichtet ist. Als
daher schon alles Derartige geordnet war, da wurden die Wissenschaften gefunden,
die sich weder auf die notwendigen Bedürfnisse, noch auf das Angenehme des
Lebens beziehen, und zwar zuerst in den Gegenden, wo man Muße hatte. Deshalb
bildeten sich in Ägypten zuerst die mathematischen Künste (Wissenschaften)
aus, weil dort dem Stande der Priester Muße gelassen war.“ (6)
Der Preis dieses Fortschritts ist die Ausbeutung des überwiegenden
Teils des Volkes durch die Herrn. Diese Arbeitsteilung in wenige Herrschende,
die sich kostenlos das gesellschaftliche Mehrprodukt aneignen, und Beherrschte,
die es produzieren, setzt die Dialektik von Herrschaft und Kultur in Gang, die
bis heute andauert. Die Muße der Herrschenden ermöglicht ihnen, den
kulturellen Fortschritt zu befördern, aber nur dadurch, dass sie die Mehrheit
von diesem Fortschritt mehr oder weniger ausschließen. Da die Arbeitenden auf
Dauer nicht freiwillig einen Teil ihres Arbeitsproduktes abgeben, muss dieses
mit Gewalt ihnen abgepresst werden. Gewalt in der Gesellschaft kommt dann nicht
mehr sporadisch vor wie in der Gentilgesellschaft, sondern wird notwendiges
Moment herrschaftlich verfasster Gesellschaften. Auch wenn die Gewalt im Recht,
etwa dem Eigentums- und Strafrecht, vorübergehend stillgestellt wird, gehört
sie doch zur „Struktur“ der Gesellschaft bis heute. Solange es auch für die
Beherrschten plausibel ist, das Mehrprodukt abzugeben, etwa weil sie dafür
Schutz bekommen oder weil die Herrschaft ein landesweites Kanalsystem zur Bewässerung
der Felder aufrechterhält, wird die durch die entstandene Herrschaft etablierte
Sitte genügt haben, den Stamm, das Volk zusammenzuhalten; fällt aber diese
Gegenleistung wegen innerer oder äußerer Krisen weg, hat das geistige Niveau
sich derart entwickelt, dass die Beherrschten nach plausibleren Gründen für
ihre Abgaben und Dienste verlangen, dann muss die vorherrschende Sitte, die die
Beherrschten in ihrer Rolle als Arbeitende fixiert, nämlich kostenlos für
andere ein Mehrprodukt zu erzeugen, ihnen als unbilliger Zwang erscheinen. Erst
in diesem historischen Moment wird die Sitte für die Gesellschaft, die aus
Herren und Knechten besteht, zum Problem. Die Priester haben deshalb die Moral
erfunden, um die Gesellschaft zusammenzuschweißen. In der Einsicht, dass die
vorherrschende Sitte einer bewussten Ergänzung bedarf, die sie den Beherrschten
plausibel macht, haben die Priester die Gebote als Sollensvorschriften
aufgestellt, sie theologisch und pragmatisch begründet, um den Verstoß gegen
das Herkommen einzudämmen. Dies lässt sich exemplarisch an der Entstehung der
Moral in der altisraelitischen Gesellschaft demonstrieren.
Zurück zum Anfang
2.
Die altisraelitische Gesellschaft und die Moral der Weisheit
Ursprünglich waren die Israeliten Nomadenstämme von
Kleintierhaltern, die in Sippen miteinander lebten, die aus mehreren Großfamilien,
in denen mehrere Generationen lebten, bestanden. Sie betrieben im Wesentlichen
Subsistenzwirtschaft. Die Sippen bzw. Familien waren weitgehend autark, auch
wenn Handwerksprodukte, vor allem Metallprodukte, aber auch Getreide
eingetauscht werden mussten. Ihre Organisation bestand in ungeschriebenen
Gewohnheitsrechten. Der Tüchtigste wird zum Anführer gewählt, wenn durch Raub
das kärgliche Leben aufgebessert werden soll. Um sich vor einer feindlichen
Umwelt behaupten zu können, existierte die Institution des Heerbanns, dessen
Befolgung jedoch freiwillig war. Zwar hatten sie bereits Richter, doch die
Durchsetzung des Richterspruchs oblag der Sippe, sie hatte gegebenenfalls die
Blutrache zu vollziehen oder zu erleiden. Zwar ist eine Individualisierung der
Sippen zu erkennen, aber der Einzelne ist nur Mitglied eines Kollektivs ohne
erkennbare Individualität. Die Sippe als wichtigste Organisation in der
Gesellschaft wird durch Verwandtschaft und dem entsprechend durch das
Bewusstsein der Genealogie zusammengehalten. Der Besitz an Vieh ist unsicher,
den Wechseln des Zufalls ausgesetzt, so dass Freigiebigkeit und Gastfreundschaft
zu den Tugenden dieser Nomaden gehörten, wie andererseits sie sich nur
behaupten konnten, wenn sie auf ihre Ehre bedacht waren, d.h. z.B., dass sie
nicht auf die Blutrache verzichten konnten, wollten sie sich vor Mord schützen.
Das religiöse Bewusstsein ist geprägt durch den Glauben an einen persönlichen
Schutzgott, durch magische Praktiken und Zaubersprüche. Um sich in einer
feindlichen Umgebung zu behaupten, schlossen sie sich zu Stämmen zusammen, die
weitgehend auch noch durch Verwandtschaftsbeziehungen geprägt, also naturwüchsig
waren. Durch diese größere Organisiertheit waren sie in der Lage, Siedlungs-
und Ackerland in Palästina zu erobern und sesshaft zu werden. Aus der
Nomadenzeit übernahmen sie ihre patriarchalische Verfasstheit. Der
Familienvorsteher, der Vater, hatte fast unbegrenzte Autorität. In der
Dorf- und Stadtgemeinde war nur er vollberechtigt. Die Basis seiner
Freiheiten war sein Erbland - auch wenn es die moderne Form des Eigentums,
über den Besitz beliebig zu verfügen, noch nicht gab. Nach der Durchsetzung
des Jhwh-Kultes galt Jhwh als Schöpfer und dadurch Obereigentümer allen
Landes. Mit der Landnahme in Palästina machten sich auch die sozialen
Differenzierungen, die bei der Kärglichkeit des Lebens bisher nur sporadisch
und unwesentlich waren, stärker bemerkbar. „Die Anführer konnten durch die
Verteilung der Beuteanteile zum Träger eines Herreneigentums werden. Da sie
zudem über größeren Besitz an Menschen und Arbeitstieren verfügten, waren
sie in der Lage, in stärkerem Maße als die anderen das Land zu roden. Das
urbar gemachte Land aber gehörte demjenigen, der es gerodet hatte. So bildete
sich allmählich eine aristokratische Ordnung heraus, gekennzeichnet durch die
beherrschende Stellung der bedeutenderen Grundbesitzer, die die in der früheren
Stammesorganisation ihnen rechtlich gleichstehenden Männern mit mittlerem oder
kleinem Besitz tatsächlich in ihre Abhängigkeit brachten und eine Oberschicht
zu bilden begannen.“ (7) Zwar gab
es bereits Sklaven, sei es durch Schuldknechtschaft, sei es durch
Kriegsgefangenschaft,
aber die Sklaven waren noch nicht die ökonomische Basis der Gesellschaft wie
etwa im antiken Griechenland oder Rom. Der Sklave war auch noch nicht rechtlos,
also keine bloße Sache wie bei den Römern. Der Lebensunterhalt wurde bei den
mittleren und kleineren Besitzern von allen Familienmitgliedern, wozu auch der
Sklave gehörte, erarbeitet. Wie in der Nomadenzeit war der Einzelne
bedeutungslos als Individuum, was sich daran zeigt, dass es keinen Begriff für
Individuum gibt, ja selbst einzelne Familienmitglieder nur durch ihre
Verwandtschaft benannt wurden. Subjekt ist die Familie, vertreten durch den
Vater, die Sippe oder das ganze Volk. In der sittlichen Vorstellung drückt sich
die Stellung des Einzelnen dadurch aus, daß als wichtigste Lehre die
Gerechtigkeit galt, das war die Orientierung des Einzelnen an der Familie, der
Sippe oder dem Stamm, später auch dem ganzen Volk: „Gerechtigkeit heißt
Gemeinschaftstreue“. (8) Das
patriarchalische Familienverhältnis wurde analog auf die Gemeinde übertragen,
die von „Ältesten“ regiert wurde. Die Israeliten mussten sich, um zwischen
bereits staatlich verfassten Stadtgesellschaften bestehen zu können, selbst
eine staatliche Organisation geben. Das gelegentliche Zusammenkommen der Stämme
zu kriegerischen Einsätzen, der Heeresbann, reichte nicht aus, um gegen die
zivilisatorisch überlegenen Bewohner Palästinas bestehen zu können. In den
Königen Saul, David und Salomo fanden sie Anschluss an die damalige
Kulturentwicklung. Dieser Fortschritt bedingte, dass die ehemals freien Bauern
tendenziell feudalisiert wurden, sie und die Handwerker mussten mit ihren
Steuern und ihrem Arbeitsdienst diesen Fortschritt bezahlen. War ein Mehrprodukt
Voraussetzung der Landnahme, so erhöhte der durch die Landnahme ermöglichte
materielle Fortschritt die Mehrproduktion und stellte mehr Menschen von der
Arbeit frei, so dass sie sich organisatorischen, kulturellen und Wissensaufgaben
widmen konnten. So reformierte Salomo das Heer, das längst nicht mehr
sporadisch zusammentrat, sondern zum stehenden Heer aus Berufssoldaten geworden
war (jedenfalls, die Kerntruppe: das Streitwagenkorps). Er vergrößerte den
Beamtenapparat, errichtete Handelsmonopole und passte seine Hofhaltung der üblichen
Pracht seiner Nachbarvölker an. In seiner üppigen Bautätigkeit verschwendete
er einen Teil des Mehrprodukts als Darstellung und Legitimation seiner
Herrschaft. Dies war nur möglich durch die verstärkte Ausbeutung seines
Volkes, also vor allem der ärmeren Massen. Das „Erste Buch der Könige“ im
Alten Testament berichtet denn auch über Klagen des Volkes gegen diese erhöhte
Abschöpfung des Mehrprodukts, die allerdings erst nach seinem Tod offen dem
Sohn gegenüber geäußert werden: „Dein Vater hat uns ein hartes Joch
auferlegt. Erleichtere du Jetzt den harten Dienst deines Vaters und das schwere
Joch, das er uns auferlegt hat“. (Kön 12, 4‑5) (Das Alte Testament als
historische Quelle ist allerdings problematisch. So haben neuere Ausgrabungen
gezeigt, dass die Bautätigkeit dieser Könige gar nicht so groß gewesen sind,
wie im Alten Testament dargestellt wurde. Für das moralische Bewusstsein ist
dies allerdings unerheblich, da es hier in erster Linie um die in den Legenden
vorgestellten Argumente und Probleme in Bezug auf die Moral geht.) Die Folge
dieser Ausbeutung war eine Verarmung der Bauern und Handwerker, andererseits
eine Steigerung des Reichtums der sich festigenden Herrschaften. War der Kampf
gegen die feindlich gesinnte Umwelt ein Grund für die Königsherrschaft, so
schaffte diese zugleich neue Konflikte. Der Konflikt zwischen Beherrschten und
Herrn durch die Abpressung des Mehrprodukts reproduziert sich in dem Stand der
Herrschenden als Konflikt um den Anteil an diesem Mehrprodukt:
Thronstreitigkeiten, Abspaltungen von einzelnen Stämmen oder die Teilung in
Juda und Israel, Verhinderung von Aufständen einzelner Städte. Zu diesen neuen
Konflikten blieben die alten bestehen: Kampf gegen NaturunbiIlen, Behauptung des
eroberten Landes und deshalb ein permanenter Krieg mit den umliegenden Völkerschaften,
Niederhalten tributpflichtiger Völker, Abwehrkriege gegen räuberische
Kamelnomaden, Sicherung der Handelswege und schließlich die Bedrohung durch die
Großreiche im Nahen Osten. Eine solche Konfliktlage droht ständig die
Gesellschaft, die in sich immer mehr in Arm und Reich gespalten ist, zu
sprengen. Gewalt als einziges Mittel, sie zu kitten, reicht nicht mehr aus. Eine
Antwort der Herrschenden, um den Zusammenhalt der Gesellschaft zu sichern, der
die
Basis ihrer Herrschaft war, ist die Erfindung der Moral (bzw. die Übernahme
einer Entwicklung des Denkens, die im alten Ägypten bereits bestand).

Nach dem Tod wurde nach altägyptischem Mythos das Herz
des Toten als Sitz seiner Seele gewogen. Wenn die schlechten Taten dem Gewicht
seines Herzens überwogen, dann fraß der schakalartige Gott das Herz, so dass
der Sünder nicht im Jenseits weiterleben konnte.
Die Moral der Weisheit besteht aus zu Merksätzen
verdichteter Lebenserfahrung. Mit ‚Weisheit’ wird ein Denken bezeichnet, das
aus der Betrachtung der Ordnungen des Kosmos, der Natur und der Gesellschaft
Regeln entwickelt, die bei ihrer Beherzigung den Lebenserfolg des Menschen
sichern sollen. Die Erfahrung kann die Ordnung der Welt nur partiell erkennen,
weil nur Einzelphänomene der empirischen Erfahrung zugänglich sind; deshalb
sind Sprichwörter, Merksätze, Epigramme und Rätsel die angemessene
literarische Form dieser Moral, die Verallgemeinerung von Einzelerfahrungen zu
partiellen Regeln. Die vorexilische Weisheitsmoral, deren älteste Schicht Prov
10 - 31 darstellt, ist zunächst Standesmoral der Königsbeamten, zu deren
Ausbildung und Amtsführung sie dient. Neben den Berufsschreibern können hauptsächlich
nur die Beamten lesen und schreiben. „Wie das Knurren des Löwen ist der Zorn
des Königs, wie Tau auf den Gras sein Wohlwollen“ (Prov 19,12)(9). Die Natur
wird zum Modell gesellschaftlicher Phänomene. Das Verhältnis von Ursache und
Wirkung soll das Verhalten leiten: „Wie das Knurren des Löwen ist der Zorn
des Königs, wer ihn erzürnt, verwirkt sein Leben“ (Prov 20,2). Aber nicht
einfach Anpassung ist gefordert, sondern die aktive Ausführung der Pflichten.
Wer diese nicht erfüllt, muss mit sozialer Deklassierung rechnen: „Noch ein
wenig schlafen, noch ein wenig schlummern, noch ein wenig die Arme verschränken,
um auszuruhen, da kommt die Armut wie ein Wanderer über dich und die Not wie
ein Bewaffneter“ (Prov 24,30-34). Als Grund, die soziale Hierarchie zu
akzeptieren, wird die Erhaltung des Volkes genannt: „Ohne Führungskunst kommt
ein Volk zu Fall, aber Rettung ist dort, wo viele
Ratgeber sind“ (Prov 14) . Das Schema von gut
und böse wird dadurch bestimmt, ob jemand den Regeln und Gesetzen folgt
oder nicht, ein ambivalentes Verhalten ist nicht denkbar: „Durch den Segen des
Aufrechten erhebt sich eine Stadt, aber durch den Mund des Frevlers wird sie
eingerissen“ (19,11). Dass ein Befolgen der Gesetze und Sitten nicht mehr naturwüchsig ist,
kommt dadurch zum Ausdruck, dass rechte Worte nötig sind, offene Ohren und
Einsicht in die Weisheitslehren: „ Mit dem Mund verdirbt der Ruchlose seinen Nächsten,
aber durch Kenntnis werden die Gerechten gerettet“ (Prov 19,9). „Die
Einsicht eines Menschen macht ihn langmütig, sein Schmuck ist es, über
Verfehlungen (anderer) hinwegzugehen“ (Prov 19,11). Werden bewusst Regeln
aufgestellt und Einsicht gefordert, steht die traditionelle Sitte sofort zu
Disposition. Sie ist nur gerechtfertigt, wenn sie einsichtig ist. Damit wird sie
dem überlegenden Denken unterworfen. Weitere Tugenden neben „Langmut“ sind
„Selbstbeherrschung“, „Demut“, „Bescheidenheit“, an ihnen erweist
sich die Ehre des Menschen; abgelehnt werden „Jähzorn“, „Torheit“,
„Eifersucht“, "Stolz“ und „Hochmut“. Die Tugenden sind funktional für
eine dienende Beamtenschaft, während die Laster die Ausführung der königlichen
Erlasse gefährden würden. Damit die Spannung zwischen Arm und Reich die
Gesellschaft
nicht sprengt, muss die Standesmoral auf einen Ausgleich bedacht sein: „Wer
seinen Nächsten verachtet, verfehlt sich, wer sich aber der Elenden erbarmt –
wohl ihn“ (Prov 14,21). Die
meisten Sprichworte beziehen sich weniger auf einklagbares Recht, sondern
appellieren an die Freiwilligkeit des Einzelnen, an seine Einsicht und zeigen
die negativen Konsequenzen für sein Leben auf, die aus einer Verletzung der
Moral folgen würden. Soll er aber auf die Vergeltung des Bösen verzichten, wie
es der Übergang von der Selbstjustiz zu gerichtlicher
Verfolgung verlangt, dann ist dies aus
seiner Lebenswirklichkeit nicht einsichtig, es bedarf für die Weisheitslehrer
des Gottes als Garanten der Ordnung. „Jhwh läßt das Verlangen des Gerechten
nicht ungesättigt, aber die Gier der Frevler stößt er zurück“ (Prov
10,3). Wird die Blutrache und die Selbstjustiz durch Gerichte mit
Sanktionsgewalt abgelöst, dann muss die praktische Solidarität auch auf den
Rechtsgegner („Feind“) ausgedehnt werden: „Sage nicht: Ich will das Böse
vergelten, vertraue auf Jhwh, er wird dir helfen“ (Prov 20,22). „Wenn dein
Feind Hunger hat, speise ihn mit Brot, wenn er Durst hat, gib ihm Wasser zu
trinken. ( ... ) und Jhwh wird es dir vergelten“ (Prov 25,11). Die höchste
Tugend, die Gerechtigkeit als Gemeinschaftstreue, ist moralische Voraussetzung
des Zusammenhalts einer sozial differenzierten Gesellschaft. Der König
wird aufgefordert: „Öffne deinen Mund für einen Stummen, für das Recht
aller Schwachen. Öffne deinen Mund, richte gerecht! Und schaffe Recht dem
Elenden und Armen“ (Prov 31, ? f.). „Güte und Wahrheit behüten den König,
und er stützt durch Güte seinen Thron“ (Prov 20,28). Hier zeigt sich die
Ambivalenz der Moral für die Herrschaft. Moral dient dazu, die Herrschaft in
gesellschaftlichen Krisen und antagonistischen Konflikten abzusichern; zugleich
wird die Herrschaft an ihrer eigenen Moral gemessen, ob sie ihr entspricht.
Entspräche die Herrschaft nicht ihrer eigenen Moral, dann würde die Wirkung
dieser Moral in der Gesellschaft verpuffen, weil sie nicht Ernst genommen werden
könnte; entspricht die Herrschaft aber ihrer Moral - und sei es einer
Standesmoral -, dann wird die Herrschaft selbst verändert, sie unterwirft
sich mehr oder weniger einsehbaren Kriterien, wird also selbst rationaler als in
der vormoralischen Epoche. Die Weisheitsmoral wird zur Kritik an der falschen
Herrschaftsausübung. „Viele suchen das Angesicht eines Herrschers, aber vor
Jhwh kommt das Recht eines jeden!“ (Prov 29,26)
„Ein König richtet das Land durch Recht auf, wer Abgaben erpreßt,
reißt es ein“ (Prov 29,4), (was wohl heißen soll, wer Abgaben über das üblicherweise
ihm Zustehende hinaus erpresst). Ist die Herrschaft unerträglich, kann sogar
auf die Natur verwiesen werden, in der Ordnung ohne Zwang, d.h. Anarchie, zu
beobachten ist: „Die Ameisen sind kein starkes Volk, aber sie besorgen sich im
Sommer ihre Nahrung“ (Prov 30,25). Die Weisheitsmoral war aus der
Lebenserfahrung gewonnen. Zeigt diese Erfahrung aber immer wieder, dass der
Unmoralische Erfolg hat, während der Moralische in Not gerät, dann wird diese
Art der Moralbegründung und mit ihr die Moral selbst fragwürdig. Die
Weisheitslehrer reagieren zwar auf die Diskrepanz zwischen moralischem Verhalten
und mangelnden Erfolg im Leben: „Durch Unrecht erworbene Schätze nützen
nichts, aber Gerechtigkeit rettet vor dem Tod“ (Frov I0,2), aber gerade diese
Reaktion macht das Faktum der Diskrepanz erst deutlich: „Der Frevler macht trügerischen
Gewinn, wer Gerechtigkeit aussät, hat beständigen Lohn“ (Prov 11 8).
„Besser ein Armer, der ohne Schuld lebt, als ein Reicher, der krumme Wege
geht“ (Prov 28,6), das heißt doch wohl, dass oft der Unmoralische zu Reichtum
kommt. Diese „Aporien der Differenz von Ethos und gelingendem Leben“ (10) werden in dieser Moral auch dadurch erklärt, dass alle
menschliche Weisheit vor Gott ihre Grenze findet. „Keine Weisheit gibt es und
keine Einsicht, keinen Rat, der gegenüber Jhwh bestehen kann“ (Prov 21,30).
Ist die Weisheit des Gottes aber für den Menschen nicht einsehbar, dann ist die
Absicherung der weisheitlichen Moral durch Gott selbst zweifelhaft. Hinzu kommt,
dass die Partikularität der Moral als Standesethos der Herrschenden wie die
unsystematische Form der Sprichworte zu offenen Widersprüchen zwischen den
isolierten Sätzen führen müssen, zumal die Sprichworte aus den
unterschiedlichsten Quellen stammen. Sollen die Sprichworte einen Ausgleich
zwischen Arm und Reich bewirken und zugleich diese soziale Differenz
rechtfertigen, dann müssen sich die Widersprüche zwischen den einzelnen Sätzen
vor allem bei den sozialen Gegenständen zeigen: „Lässige Hand bringt Armut,
fleißige Hand macht reich“ (Prov 10,4) (11 a) - im Widerspruch zu - „Der Segen des Herrn macht reich, eigene Mühe tut nichts hinzu“
(Prov
10,22). „Reichtum hilft nicht am Tag des Zorns, Gerechtigkeit aber rettet vor
dem Tod“ (11,4) - im Widerspruch zu - „Dem Reichen ist seine
Habe eine feste Burg, dem Armen bringt seine Armut Verderben“ (10,15). „Der
Gerechte hat zu essen, bis sein Hunger gestillt ist, der Bauch der FrevIer aber
muß darben“ (13,25) - im Widerspruch zu - „In der Hand der
Vornehmen ist reichlich Nahrung; der Arme wird zu Unrecht dahingerafft“
(13,23).
Verstärkt sich die gesellschaftliche Krise in der
israelitischen Gesellschaft, wie dies durch die Bedrohung der Großreiche und
die Verschärfung der sozialen Konflikte in der vorexilischen Zeit der Fall war,
dann wird diese Krise zum Anlass für die Priester und Propheten, eine
durchdachtere Moralauffassung zu entwickeln. Recht und Ethos wurden mehr
theologisch fundiert, teilweise utopisch erweitert (11). Doch auch diese Art der
Moralbegründung scheitert an der Erfahrung mit der Gesellschaft. „Die
prophetischen Überlieferungen des 8. und 7. Jh. zeigen, daß sich auch die
theologisch begründeten Normen nicht durchsetzen konnten. Eine Begrenzung des
Pfandrechts (Mi 2,1 f.; Am 2,6.8; 5,11; Hab 2,6b) und eine Abschaffung des
Zinses zugunsten des zinsfreien Notdarlehns
i st nicht
realisiert worden. Den Witwen, Waisen und Bedrückten wurde nicht zum Recht
verholfen (Jes 1,17). Das Prozessrecht, das Bestechung verbietet, wurde nicht
befolgt, (Am 5,10.12) und die Sklavenfreilassung im siebten Jahr nicht vollzogen
(Jer 34,8 ff.). Der Gesellschaftsprozeß der zunehmenden sozialen
Differenzierung lief dem theologisch legitimierten Recht und Ethos diametral
zuwider. Die soziale Differenzierung in arme und reiche Schichten verbunden mit
der sich durchsetzenden Wirtschaftsform des „Rentenkapitalismus“ (?) sowie
die zunehmende Arbeitsteilung und Mobilität, die tendenziell die Bevölkerungsballung
in den städtischen Zentren nach sich zog, zerrüttete die traditionelle
Erbbodenordnung und damit die Bindung der Familien an ihren Grund und Boden (Mi
2,1-4; Jes 5,8 u.ö.)." (12) Entsprechen
die theologisch legitimierten Normen nicht der Lebenswirklichkeit, muss das zur
Negation der Gottesvorstellung des diese Normen legitimierenden Gottes führen
oder zur Prophetie des Untergangs des unmoralischen Volkes. Letzteres läuft auf
eine völlige Hoffnungslosigkeit hinaus, die der Funktion der Moral,
gesellschaftliche Einheit zu stiften, diametral zuwiderläuft. Deshalb hat sich
bei den Schriftgelehrten eine metaphysische Begründung der Moral und des Rechts
durchgesetzt, die von der Empirie völlig losgelöst ist.
Zurück zum Anfang
3.
Die Moral des Dekalogs
Die neue Moraltheologie, wie sie uns hauptsächlich im
Dekalog, dem Bundesbuch und dem Deuteronomium entgegentritt, deren Endredaktion
nachexilisch (nach 520 v.u.Z.) ist, geht nicht empirisch vor, sondern
legitimiert die Moral- und Rechtsgebote aus Gott, gibt also eine
metaphysische Begründung. Gott ist Weltprinzip (Schöpfer der Welt),
personifizierte Naturmacht (sendet Blitz und Donner, Hagel und Sturm oder bringt
gutes Wetter) und zugleich noch nicht erkannte, deshalb fremde praktische
Vernunft des Menschen. Die Strukturen des Seins und das, was die Menschen darüber
wissen, sind noch ungeschieden, in eins gedacht, das Bewusstsein steht noch auf
dem Standpunkt einer naiven Ontologie. Doch die Differenz von ontologisch
gedachtem Sein und Bewusstsein des Menschen ist an sich schon bewusst als
Differenz zwischen Gott als Weltprinzip und der unvollständigen Erkenntnis des
Menschen von Gott und der Natur. Insofern die Menschen von Gott als Vernunft
wissen, haben sie ein Selbstbewusstsein, aber sie wissen nicht, dass es ihre
Vernunft ist,
so ist ihnen ihr Selbstbewusstsein ein fremdes. Als noch fremdes
Selbstbewusstsein des Menschen gibt Gott die Gebote des Handelns. Dieses fremde
Selbstbewusstsein des Menschen entwickelt sich für den Menschen aus den
Erfahrungen der Geschichte der Israeliten. Die Deuter dieser historischen
Erfahrung sind zuerst die Weisen, dann Propheten und Priester, schließlich auf
deren Schriften aufbauend die Schriftgelehrten. Sie interpretieren die
historischen Erfahrungen, indem sie versuchen, das Allgemeine darin, zu
erkennen. Ist dieses zwar aus empirischen Erfahrungen gewonnen, so wird es doch
als Offenbarung Gottes und damit eines metaphysischen Allgemeinen vorgestellt.
Da sich das menschliche Selbstbewusstsein noch fremd ist, teilweise seine Kräfte
nur in mythologischer Form kennt (z.B. ist die göttliche Weltschöpfung als
creatio ex nihilo mythologischer Ausdruck der Schöpferkraft des Menschen), ist
auch die Begründungsweise, mit denen Handlungsprinzipien gegeben werden, noch
teils dunkel, teils mythologisch, bestenfalls pragmatisch vorhanden. Obwohl das
logische Prinzip des zu vermeidenden Widerspruchs bereits die einzelnen Autoren
implizit prägt, ist der Sammelcharakter der Tora insgesamt nicht überwunden
und damit nicht die offensichtlichen Widersprüche zwischen den Textteilen. Die
Begründungen, die ich für die einzelnen Gebote gebe, sind zwar implizit
herauslesbar bzw. aus der Historie ableitbar, aber nicht explizit formuliert.
Insgesamt verbleibt die alttestamentliche Moral noch im Mythologischen, auch
wenn die Mythologie in sich selbst aufklärerische Momente entwickelt und vor
allem die Tendenz zum Monotheismus ein Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit
darstellt.
Der Dekalog (Zehn-Wort) entsteht im Zusammenhang mit
der größten Krise des israelischen Volkes vor der Diaspora, der Exilzeit.( 14
) Der letzte israelische Staat Judäa
ist von der Großmacht Babylon endgültig besiegt, hat seine Staatlichkeit
eingebüßt; seine Oberschicht ist nach Babylon ins Exil verschleppt, die Zurückbleibenden
passen sich der neuen Herrschaft an und verehren deren Götter, fremde
Volksgruppen wandern ein, besetzen das freigewordene Land und vermischen sich
mit den zurückgebliebenen Israeliten; statt nach Recht und Sitte friedlich
zusammenzuleben, können die meisten nur überleben, wenn sie alle bisherigen
Regeln missachten; dadurch wird die alte Sitte gänzlich zerstört, ihr
wichtigster Grundsatz, die Gemeinschaftstreue, ist bedeutungslos,
wenn sich jede Art Gemeinschaft auflöst. In dieser historischen
Situation bleibt nur die Hoffnung auf Rückkehr und Neuanfang, sie wird für die
Priester und Propheten der Anlass, eine neue Ordnung für das zukünftige Reich
zu entwickeln. Auch wenn diese Ordnung zum Teil utopische Züge trägt, wie z.B.
die geplante Neuaufteilung des Bodens,
nach der jede Familie den gleichen Anteil bekommen sollte, wird doch auf der
Basis der alten Sitten und des alten Rechts eine neue realitätstüchtige
Ordnung konzipiert. In diesem Zusammenhang entstehen die Zehn Gebote, sie drücken
die Einsicht aus, dass Recht und Sitte nicht mehr ausreichen, den Zusammenhalt
der Gesellschaft zu gewährleisten, sondern dazu eine individuelle Anstrengung
des Einzelnen notwendig ist. Die Krise des Exils hat die Einheitsvorstellung von
Gesellschaft und Individuum, die bisher schon einen moralischen Kraftakt zu
ihrer Realisierung bedurfte, um bestehen zu können, zerstört. „Der Einzelne
sieht sich mehr und mehr auf sich selbst gestellt“ (13), er wird zum Subjekt
seiner Handlungen. Galt früher eine Strafe bis zum 4. Glied der Nachkommen,
weil vier Generationen in einer Familie lebten und der Einzelne nur Teil seiner
Familie war, so gilt nun: „Nur wer sündigt, soll sterben. Ein Sohn soll nicht
die Schuld seines Vaters tragen und ein Vater nicht die Schuld seines Sohnes.“
(Ez 18, 20) Zwar geht der Dekalog
noch nicht so weit bei der Individualisierung, Gott bestraft seine Feinde
weiterhin bis zur vierten Generation (Ex 140,5), also die ganze Sippe, dennoch
ist auch hier die Rolle des Einzelnen schon dadurch hervorgehoben, dass er
durchgehend mit ‚du sollst’ angesprochen wird. Dass es im Dekalog genuin um
Moral geht und nicht um Wiederholungen von Rechtsvorschriften etwa des
verwandten „Bundesbuches“ (Ex 20,22 - 31,118), wird an der
sprachlichen Form offensichtlich: es werden keine Verbote mit entsprechender
weltlicher Strafandrohung ausgesprochen, sondern die Gebote appellieren an den
Einzelnen, dessen Fehlverhalten sie verhindern wollen. Damit wird auf eine
Verinnerlichung gesellschaftlicher Regeln insistiert, die im zehnten Gebot
explizit formuliert ist. Appellierende Gebote und ihre Verinnerlichung sind aber
nur denkbar unter der Voraussetzung, dass der Einzelne für seine Handlungen voll
verantwortlich ist - eine entscheidende Bedingung von Moral. Es geht um
moralische Appelle, die vor einer möglichen Fehlhandlung erfolgen oder um
positive Aufforderungen, die ein Handeln verlangen, das nicht justiziabel ist
wie die Sorge für die Eltern (siehe fünftes Gebot). Auch die metaphysische
Absicherung der Gebote, indem sie als Gebote Gottes und nicht als pragmatische
menschliche Weisheit ausgegeben werden, ist ein Indiz für die versuchte
Moralisierung menschlicher Beziehungen. Denn Gott sieht auch die heimlich
begangenen Sünden und fehlgeleiteten Absichten, im Gegensatz zur menschlichen
Justiz, die nur äußerliche und offensichtliche Handlungen beurteilen kann. Im
einzelnen sind die Gebote aus früheren konkreten Vorschriften hervorgegangen,
so ist z.B. das rechtliche Verbot, keinen Menschen zu stehlen, auch auf Sachen
ausgedehnt und dadurch universalisiert worden zu: „Du sollst nicht stehlen.“
Im zehnten Gebot ist diese Universalisierung selbst vorgeführt. Weitere
entscheidende Neuerungen sind die Systematisierung und die Zehnzahl, obwohl die
Form noch additiv ist und erst später und unterschiedlich nach der Zehnzahl
gegliedert und katechisiert wurde.
Allerdings wird im Deuteronomium bereits von „Zehn Worten“ (10,4)
gesprochen. „Dem sprachlich-historischen Befund wird am ehesten die Zählung
des Fremdgötterverbots als 1., des Bilderverbots als 2. Gebot gerecht.“ (15)
Die anderen Gebote ergeben sich dann zwangsläufig, wenn man eine
Zehnzahl zugrunde legt.
Der Dekalog im Überblick:
| Gott in Ich-Form |
1. Verbot fremder Göttern |
Negatives Gebot |
Theologisches Gebot |
| Gott in Ich-Form |
2. Bilderverbot |
Negatives Gebot |
Theologisches Gebot |
| Gott in Er-Form |
3. Namensmissbrauch |
Negatives Gebot |
Theologisches Gebot |
| Gott in Er-Form |
4. Sabbatgebot |
Positives Gebot |
Theologisches Gebot |
| |
5. Elterngebot |
Positives Gebot |
Profanes Gebot |
| Kurzprohibitiv |
6. Tötungsgebot |
Negatives Gebot |
Profanes Gebot |
| Kurzprohibitiv |
7. Ehebruchsverbot |
Negatives Gebot |
Profanes Gebot |
| Kurzprohibitiv |
8. Diebstahlsverbot |
Negatives Gebot |
Profanes Gebot |
| Kurzprohibitiv |
9. Lügenzeugnisverbot |
Negatives Gebot |
Profanes Gebot |
| Kurzprohibitiv |
10. Begehrungsverbot |
Negatives Gebot |
Profanes Gebot |
Diese formale Gliederung der Gebote hat auch einen inneren
systematischen Zusammenhang, der bei der inhaltliche Erörterung dargestellt
wird, wobei die rhetorische Abfolge (nach Wichtigkeit) und die logische (begründende)
Ableitung noch ungeschieden sind. Zumindest drückt die Zehnzahl die didaktische
Absicht aus, einige wichtige Minimalregeln des Zusammenlebens der israelitischen
Gesellschaft zu geben, die für jedermann einprägbar sind. Sie ist aber kein
Kanon aller Moral oder gar Ausdruck der Grundregeln, die das Naturrecht
darstellen sollen. Auch sind die Zehn Gebote nicht mit mathematischen Axiomen
vergleichbar, als ob man aus ihnen ein ethisches System konstruieren könnte.
(16) Meine These ist, dass der Dekalog
notwendige Regeln einer Moral darstellt, vor allem die profanen Gebote, die
zur ideellen Existenzbedingung der Herrschaftsordnung der Israeliten gehören.
Nur wenn diese Gebote massenwirksam befolgt werden, kann die israelitische
Gesellschaft mit ihrer Herrschaftsordnung neu gegründet werden, so dass sie
dauerhaft auf dem damaligen Stand der Produktionsverhältnisse existieren kann.
Dementsprechend ist der Adressat dieser Gebote vorwiegend der landbesitzende
freie Vollbürger als Träger der Ordnung. Er wird auch direkt angesprochen,
wenn gesagt wird, am Sabbat „darfst du keine Arbeit tun: du, dein Sohn und
deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin, dein Vieh und der Fremde, der in
deinem Stadtbereich Wohnrecht hat“ (Ex 20, 10).
Eröffnet wird das kurze Kapitel 20 des Buches „Exodus“, das die Zehn
Gebote enthält, mit einem Prolog, in dem Gott als Befreier der Israeliten aus
dem „Sklavenhaus“ Ägypten
dargestellt wird, eine Tat Gottes, die Hauptinhalt dieses viel älteren
Geschichtsbuches „Exodus“ ist. Der folgende Dekalog ist danach die ideelle
Bedingung, die von Gott erhaltene Freiheit zu bewahren. „Auf eigenem Lande zu
wohnen, dessen Reichtum zu genießen, von Sklaverei und Fronarbeit frei zu sein
- das steht hinter der Chiffre von der Herausführung aus dem Sklavenhaus.“
(17) Da Gott den Menschen noch
fremde menschliche Vernunft ist, wird er zum fremden Befreier und Geber der
Gebote, welche die einmal erreichte Freiheit bewahren helfen sollen. Es sind
aber die Menschen selbst, die sich einen bestimmten Stand der Freiheit errungen
haben, aber sie wissen es nicht, sondern schieben ihr Wissen der
personifizierten Gestalt ihrer Vernunft zu. Da ein solcher Gott aber nicht ohne
weiteres einsichtig ist, muss folglich das erste Gebot der Absicherung dieses
Gottes dienen, der die Grundlage (Geber) aller folgenden Gebote ist.
Zurück zum Anfang
4.
Die Gebote im einzelnen
Das 1. Gebot:
„Du sollst neben mir keine anderen Götter haben.“ (Ex
20,3)
Jede Verehrung und Anerkennung anderer Götter wird
verboten, obwohl die Existenz anderer Götter damit vorausgesetzt wird, also
kein Monotheismus vorliegt. Der Gott, der den israelitischen Vollbürgern die
Freiheit brachte, bleibt die Bedingung der Erhaltung dieser Freiheit; er darf
deswegen nicht entehrt werden, indem man von ihm abfällt. Im Gegensatz zu den
polytheistischen Göttern, die eine gewisse Toleranz bei der Verehrung anderer Götter
gestatteten, bezeichnet sich Jhwh selbst als einen „eifersüchtigen Gott“
(Ex 20,5). Dieser Alleinvertretungsanspruch ist in der Vereinheitlichung aller
Lebensbereiche durch ihre Theologisierung begründet. Die Theologisierung in
Richtung des Monotheismus korrespondiert zugleich mit einer Entzauberung der
Welt. Dadurch gelangen die Priester zu einer Rationalisierung des Weltverständnisses
in der Bedeutung der Vereinheitlichung des Denkens und seiner Konzeptionen, ohne
dass der Schritt zur selbstbewussten Rationalität wie bei den Griechen gegangen
wird. Vereinheitlichung bedeutet dann auch, die Gebote an der
Widerspruchsfreiheit zu orientieren, ohne dieses Prinzip bewusst auszusprechen.
Wie die menschliche Vernunft eine gewisse Freiheit haben muss, wenn sie die
Handlungen mit den Geboten wahrhaftig überprüfen will, so muss auch die fremde
Gestalt dieser Vernunft als frei bestimmt werden, wenn sie die Schuld der
Menschen abwägt. Diese Freiheit Gottes kehrt das Verhältnis des Menschen zu
den Göttergestalten der vorgängigen Mythologie um: Diese „Götter sind darin
Funktion des menschlichen Wunsches nach gelingendem Leben. Das Gebot der
Alleinvertretung Gottes durchschlägt diese Wunschprojektionen, die die Religion
im Dienste vorfindlicher Interessen des Menschen funktionalisiert, und kehrt das
Begründungsverhältnis um: Gott soll nicht verehrt werden, weil der Mensch
leben will und Gott also braucht, sondern weil Gott Gott ist, will er von den
Menschen anerkannt und verehrt werden – allein um der Gottheit Gottes
willen.“ (18) Diese
Selbstzweckhaftigkeit Gottes ist die Voraussetzung dafür, dass der Mensch nicht
nur befangen ist in dem undurchschaubaren Miteinander und Gegeneinander der
Triebe, Bedürfnisse und Interessen, sondern sich als moralisches Wesen begreift,
das auch Selbstzweck sein kann, indem es die anderen Vollbürger als Selbstzweck
anerkennt. Gott ist der Urheber von Geboten, die soziale Konflikte schlichten
oder gar verhindern sollen, er kann deshalb nicht selbst Partei in diesen
Konflikten sein, er muss diesen gegenüber transzendent bleiben. Da Gott nicht
nur fremde menschliche Vernunft ist, sonder zugleich personifizierte allgemeine
Naturmacht, wird diese immanente Transzendenz zur Transzendenz gegenüber der
Welt gesteigert. Als transzendenter Gott braucht er innerweltliche Vollstrecker
seines Wollens; entsprechend wird die Übertretung des ersten Gebots nicht nur
durch die Drohung, Gott werde diese Sünde vergelten, abgesichert, sondern auch
durch die weltliche Gerichtsbarkeit Israels bestraft (vgl. Dtn 17, 2-7). Diese
doppelte Absicherung ist beim ersten Gebot besonders nötig, weil mit dessen
Verletzung nicht nur ein Sakrileg begangen, nicht nur eine Rechtsbestimmung übertreten,
sondern die ganze Rechtsordnung negiert, ihrer Grundlage beraubt würde.
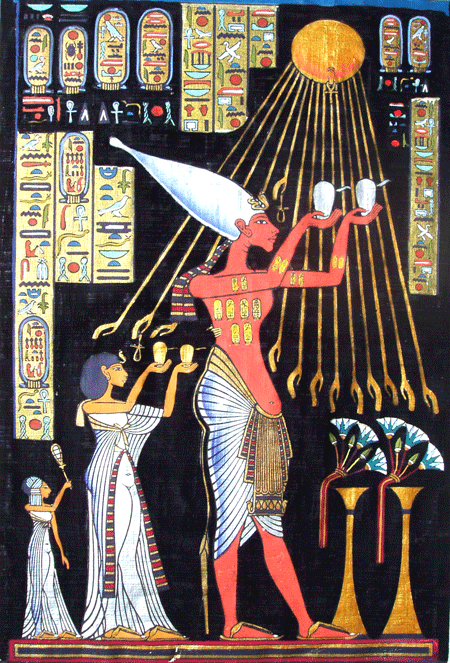
Der Sonnengott Aton wurde von dem Pharao Echnaton (hier
mit Frau und Tochter) um 1364 v.u.Z. zur alleinigen Gottheit erklärt. Die
Priesterschaft rächte sich nach seinem Tod und tötete einige Mitglieder seiner
Familie.
Interpretiert man die Geschichte des menschlichen Geistes
von seinen religiösen Anfängen bis zu den avanciertesten Gestalten heutiger
Philosophie als Entwicklung zum wahren Denken, dann ist mit diesem Gebot die
dianoetische Tugend ausgesprochen worden, der Vernunft die Treue zu halten, kein
Sacreficium intellectus zu begehen. Das ist der rationale Gehalt des ersten
Gebotes. Angesicht der Korrumpierung des menschlichen Geistes durch Ideologien
und die Bewusstseinsindustrie ist dieser Gehalt aktueller denn je. Die Schranke
des ersten Gebotes liegt in seiner religiösen Form: Wird eine neue Gestalt des
Denkens entwickelt, dann kann aufgrund des mangelnden rationalen
Selbstbewusstseins die alte Gestalt der Möglichkeit nach nicht durch Kritik
abgelegt werden, sondern allein durch Krieg. Heteronome Moral ist grundsätzlich
nicht veränderbar - auch wenn sich die Lebensverhältnisse ändern -, ohne
diese Gestalt des Bewusstsein mit Gewalt zu stürzen. (Gewalt ist auch zu ihrer
Einführung nötig, siehe unten.) Einige Propheten haben ihre neuen
Vorstellungen denn auch mit Gefängnis und Tod bezahlt. Die menschliche Vernunft
ist noch nicht bei sich selbst, sondern hängt quasi noch am Naturzustand.
Zurück zum Anfang
Das 2. Gebot:
„Du sollst dir kein Gottesbildnis machen und keine
Darstellung von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser
unter der Erde.“ (Ex 20,4)
Als das erste Gebot einschließlich Begründung wird
gesagt: „Du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen und dich nicht
verpflichten, ihnen zu dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger
Gott: Bei denen, die mir feind sind, verfolge ich die Schuld der Väter an den Söhnen,
an der dritten und vierten Generation; bei denen, die mich lieben und auf meine
Gebote achten, erweise ich Tausenden meine Huld.“ (Ex 20, 5-6)
Gott gibt Prinzipien, denn die Gebote haben die logische
Form von Prinzipien. Sie sind ein „Erstes“ vor allen Handlungen. Prinzipien
sind aber nicht mehr anschaulich, sondern allgemein geltend und damit geistige
Gebilde. Folglich kann auch der Gott, der sie gibt, nicht mehr anschaulich sein.
Die durch Prinzipien gewonnene Distanz zur unmittelbaren Wirklichkeit verschafft
den Menschen ein Stück Freiheit ihr gegenüber, die zur Freiheit Gottes
stilisiert wird. Freiheit und Geist aber sind nicht abbildbar. Das Bilderverbot
folgt also konsequent aus der Transzendenz Gottes, auch wenn im Alten Testament
dieses zweite Gebot unvermittelt an das erst angereiht wird. Jhwh kann nicht in
seiner Schöpfung aufgehen, sonst wäre er nur ein Teil von ihr, nicht aber ihr
Schöpfer. Gelten Prinzipien für alle möglichen Fälle, die sich unter sie
subsumieren lassen, dann sind sie tendenziell unendlich, also muss auch das sie
gebende Vermögen diese Unendlichkeit haben. Jhwh als unendlicher kann nicht
durch Endliches wie die anschaulichen Götter der israelitischen Umwelt
dargestellt werden. Das Bilderverbot sichert die Transzendenz Gottes ab und
damit auch seine Unverfügbarkeit für den Menschen. Alles Materielle und
deshalb Anschauliche ist mehr oder weniger für die partikularen Interessen der
Menschen verfügbar, so auch die Vergegenständlichung eines Gottes. Nur über
einen konsequent transzendenten Gott als Ausdruck kollektiver Vernunft kann der
einzelne Mensch nicht verfügen. (Allerdings deutet der Zusatz über Himmel,
Erde, Wasser auch auf das Verbot der naturwissenschaftlichen Forschung hin!)
Wie Gott heilig (unantastbar) ist, so sind es auch seine Gebote, ob sie
in der empirischen Welt befolgt werden oder nicht. Diese notwendige Konstruktion
moralischer Prinzipien enthält die unreflektierte Aporie, dass diese
Prinzipien nur als unbedingte in der Praxis wirksam werden können, obwohl sie
doch aus dem Interesse an dieser Praxis ihr Entstehung durch die Priester
verdanken, also bedingt sind. (Selbst in der Kantischen Philosophie ist diese
Aporie noch nicht ausreichend reflektiert.)
Zurück zum Anfang
Das 3. Gebot:
„Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht
mißbrauchen;
denn der Herr läßt den nicht ungestraft, der seinen Namen mißbraucht.“ (Ex
20,7)
Dieses Gebot soll den Umgang mit Jhwh absichern: Sein Name
soll nicht beim Fluchen, bei Zauberei, Gotteslästerung, falschen Gelübden und
falscher Prophetie missbraucht werden. Ursprünglich ist wohl das falsche Schwören
entscheidend gewesen. Diese Absicherung des assertorischen Eids (19) wird im
dritten Gebot ausgeweitet und jede Art, den Namen zu missbrauchen, verboten.
Entsprechend der naiven Ontologie, die dem Alten Testament zu Grunde liegt, sind
Namen nicht „Schall und Rauch“ wie später im Nominalismus, sondern der Name
drückt das Wesen der Sache aus bzw. ist es selbst, sein Missbrauch greift
direkt diese Sache an. Mit diesem Gebot soll ebenfalls die Stellung des Gottes
als Gesetzgeber und Garant dafür, dass die Gebote und Gesetze durchführbar
sind, abgesichert werden. Diese Absicherung wird durch die Strafdrohung bekräftigt,
nach der Gott denen nicht vergibt, die seinen Namen missbraucht haben (Ex 20,7).
Gott erscheint damit als eine äußere Gestalt des menschlichen Gewissens. Der
Gehalt des dritten Gebotes besteht in der Veräußerlichung des Gewissens, für
das es noch keinen Begriff gibt.
Bestehen in einer Gesellschaft wie in der der Israeliten
Antagonismen, die durch moralische Gebote nicht beseitigt, aber stillgestellt
werden sollen, damit sie sich nicht gesellschaftszerstörend auswirken, dann
bedarf es einer über den antagonistischen Kräften stehende Instanz, welche die
Einhaltung der Gebote garantiert. Im Verbot, den Namen Gottes zu missbrauchen,
wird diese Instanz praktisch. Konnte ein Rechtsfall nicht gelöst werden aus
Mangel an Beweisen und Zeugen, dann konnte sich der Angeklagte durch einen Eid
vor dem Heiligtum rein sprechen lassen, so dass er als unschuldig galt. Kommt es
zum Streitfall, etwa zwischen einem armen Bauern und einem Großgrundbesitzer um
ein Stück Jungvieh, dessen Zugehörigkeit strittig ist, weil es keine
offensichtlichen Beweise gibt, dann kann ein Eid vor Jhwh eventuell den Streit
schlichten, wenn der Großgrundbesitzer, bei dem das Tier ist, etwa schwört,
dass das Tier tatsächlich von seiner Herde abstammt. Schwört er einen Meineid,
dann trifft ihn der Fluch Jhwhs, ohne dass seine gesellschaftliche Stellung und
Macht ihn schützen könnte. Der gesellschaftliche Antagonismus reproduziert
sich im Verhältnis von Jhwh und den Meineidigen, der vor ihn falsch geschworen
hat. Voraussetzung dafür, dass eine externe Instanz das Gemüt des Schwörenden
in Furcht hält, damit er keinen Meineid schwört, also der soziale Antagonismus
stillgestellt wird mittels Moral und Recht, ist der Glaube an Jhwh, also die
Einhaltung des ersten Gebots. Zugleich sichert das dritte Gebot auch die Kohärenz
des Kollektivs der Herrschenden bzw. des herrschenden Standes bzw. der
Oberschicht ab. (20) Denn ohne
beschworenen Zusammenhalt etwa der Krieger und Beamten in ihrer Treue zum König
ist es unmöglich, den Staat einer antagonistischen Gesellschaft
zusammenzuhalten und zu verteidigen. Da die Zugehörigkeit der Herrschenden zu
ihrem Stand nur gesichert ist, wenn seine Kohärenz gewährleistet ist, haben
sie auch ein, wenn auch langfristiges, individuelles Interesse daran, die Eide
einzuhalten. Da andererseits die Konkurrenz um das zu verteilende Mehrprodukt
dazu anreizt, Vereinbarungen zu brechen, ist die religiöse Absicherung des
Eides notwendig, sie wird in den Mindestkanon der Regeln aufgenommen, ohne die
keine Herrschaftsordnung seitdem auf Dauer bestehen kann.
Zurück zum Anfang
Das 4. Gebot:
„Gedenke des Sabbats: Halte ihn heilig! Sechs Tage darfst
du schaffen und jede Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn,
deinem Gott, geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun: du, dein Sohn und deine
Tochter, dein Sklave und deine Sklavin, dein Vieh und der Fremde, der in deinem
Stadtbereich Wohnrecht hat.“ (Ex 20, 8-10)
Das vierte Gebot wird mythologisch begründet: „Denn in
sechs Tagen hat der Herr Himmel, Erde und Meer gemacht und alles, was dazugehört;
am siebten Tag ruhte er. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und ihn für
heilig erklärt.“ (Ex 20, 11) Neben
dem Elterngebot gehört das Sabbatgebot zu den beiden positiv formulierten
Geboten: Es wird nicht verboten, sondern etwas Konkretes geboten. Angesichts der
Exilzeit, in der das Zentralheiligtum, der Tempel in Jerusalem, zerstört war,
musste der Kult auf andere Art repräsentiert werden. Die Priester erfanden dazu
den Sabbat, der privilegrechtlich abgesicherte wurde, d.h. durch
Rechtsbestimmungen, die Aussonderungen für Jhwh anordnen mit dem Ziel, diese
Aussonderung der direkten Herrschaft Gottes zu unterstellen (wie z.B. auch den Zehnten
zur Versorgung der Leviten (Priester)). Sein theologischer Gehalt
besteht in der Selbstvergewisserung des Kultes und daraus folgend die religiöse,
also heteronome Absicherung der moralischen Gebote und des Rechts. Indem die
Menschen einschließlich der Frauen, Kinder, Sklaven und Fremden nicht arbeiten,
haben sie die Muße, die Gebote und ihre mythologische Begründung sich zu
vergegenwärtigen. Praktisch geschah dies durch das regelmäßige Vorlesen der
Schriften. Insofern die religiöse Einübung die einer Moral ist, die eine
Herrschaftsordnung absichert, dient auch der Sabbat zur Festigung dieser
Ordnung. Die Muße und die dadurch ermöglichte Ausbildung des Denkens erlauben
aber auch, die individuelle Emanzipation von Fesselung an das Unmittelbare zu fördern.
Mit der Einbeziehung der Sklaven wird in diesem Gebot die Universalität der
Moral erkennbar (siehe auch zum 8. Gebot). Durch die Einhaltung dieses Gebots
hat die gesamte Gesellschaft eine Freiheit gegenüber der Natur und den
Notwendigkeiten des Überlebens in ihr erreicht, wie sie bis dahin nur den
sozial Privilegierten möglich war. Wie schwer der alltägliche Überlebenskampf
für die kleinen Bauern war, beschreibt Gen 3,17 ff. Einen Tag nicht zu
arbeiten, sondern zu ruhen, um die Schriften zu hören, war ein großes ökonomisches
Opfer, aber zugleich Ausdruck errungener Freiheit. Denn die Produktivkräfte
mussten zumindest ein derartiges Niveau erreicht haben, dass ohne Schaden die
ganze Gesellschaft einen Ruhetag einlegen konnte. „Die geforderte Ruhe ist das
praktizierte Gegenteil von Sklavenarbeit. So geht es in diesem Gebot, liest man
es vom Prolog her, um die exemplarische Wahrnehmung und Praktizierung des von
Jhwh geschenkten Status der Freiheit, in dem sich die Angeredeten befinden.“
(21)
Anmerkung zur Nächstenliebe
Obwohl explizit die „Nächstenliebe“, d.h. die
Solidarität mit dem in Not geratenen Nächsten, im Dekalog fehlt, wird sie im
Sabbatgebot dennoch angedeutet, indem auch Sklaven und Fremde, ja sogar Vieh
einbezogen werden in die Arbeitsruhe. Bei Anerkennung der sozialen
Differenzierung in Arme und Reiche, Herrn und Sklaven soll die darin enthaltene
Sprengkraft gemildert werden. So knüpft zeitlich und inhaltlich Lev 19, 1-37 an
den Dekalog an und ergänzt ihn (22).
(V 17) „Du
sollst dich nicht rächen, und du sollst nicht nachtragend sein mit deinen Mitbürgern.
Vielmehr sollst du deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin Jhwh.“
Dieses Gebot wird auch auf die Fremden übertragen:
(V 34) „Wie
ein Einheimischer von euch soll für euch der Fremde sein, der sich bei euch
aufhält. Du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn Fremde wart ich im Lande Ägypten. Ich, Jhwh, bin euer Gott.“
Liebe meint hier etwas Praktisches, dem anderen zu essen
und zu trinken geben, ihn Unterkunft gewähren, den Armen ein Almosen überlassen.
Dass die Israeliten selbst einmal Fremde waren, reicht als Begründung nicht
aus, denn andererseits haben sie bei der Landnahme ganze Städte ausgerottet
oder die Bevölkerung vertrieben. Entscheidend ist die Milderung der sozialen
Spannungen. Da es am klaren Bewusstsein der Ursachen dieser Spannungen fehlt und
das Interessenkalkül des Einzelnen zur Feindesliebe nicht ansprechbar ist (23),
kann solch ein Gebot nur durch die Autorität Gottes legitimiert werden.
Insgesamt gehört es wohl zu den utopischen Momenten dieser Moral. Dass diese
Gebote u.a. nicht in den Dekalog aufgenommen wurden, mag daran liegen, dass sie
keine notwendigen ideellen Existenzbedingungen der Herrschaftsordnung sind,
sondern diese nur raffinieren.
Zurück zum Anfang
Das 5. Gebot:
„Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst
in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt.“ (Ex 20,12)
„Ehren“ bedeutet: „Beilegen von Gewicht durch
Anerkennung“ (24), es ist immer auch praktisch zu verstehen, nicht nur als
geistige Anerkennung. Es ist das erste der profanen Gebote, durch seine positive
Formulierung und auf Grund seiner Mittelstellung ist es das zentrale Gebot auch
von seiner Bedeutung her. Die positive Formulierung hat die Absicht, das Recht
zu internalisieren, die Begründung soll überzeugen und die Einsicht befördern.
Unmittelbar fordert es die Autorität der Eltern, voran die des Vaters, zu
respektieren. Es schützt die Rechtsautorität des pater familias.
Die Frau wird anerkannt, insofern sie Mutter ist, also ihre biologische
Rolle erfüllt hat. Nicht unwesentlich ist auch die bei ihr (und dem Vater)
lebensgeschichtlich akkumulierte Erfahrung. Grundlage der individuellen Existenz
ist in Krisenzeiten mehr denn je die Familie, die durch den Vater repräsentiert
wird. Seine Autorität, die an das Erbland gekoppelt ist, hält sie zusammen,
und er vertritt sie nach außen. Wird seine Autorität zerstört, kann das zum
Zerbrechen der Familie führen, so dass auch die Existenz des Zerstörers dieser
Autorität, wenn er aus der Familie kommt, gefährdet ist; er wird nicht lange
leben auf seinem Land, wie das Gebot bei Nichtbefolgung zu recht warnt. Darin
eingeschlossen ist die Versorgung der Eltern, wenn sie alt und krank geworden
sind. Denn die Familie ist die einzige Stütze, die der Einzelne hat. Versorgen
die Kinder nicht ihre Eltern, so verkürzen sie deren Leben, schneiden sich von
den in diesen akkumulierten Erfahrungen ab und geben ihren Kindern ein
schlechtes Beispiel, so dass auch sie später, wenn sie alt und krank sind,
nicht versorgt werden und vorzeitig sterben. Es wäre aber falsch, mit Crüsemann
zu meinen, dass „der Kernpunkt die Frage der Altersversorgung“ (24)
sei, weil die Versorgung der Alten oft und vielfältig gefährdet war.
Auch wenn das Wort „ehren“ etwas Praktisches bedeutet und nicht ein bloßes
Gefühl oder bloße Worte, so ist es doch allgemein formuliert, nicht auf die
Versorgung beschränkt, auch wenn diese enthalten ist. Es wendet sich dagegen,
dass die Eltern geschlagen (Ex 21,15), verflucht (Ex 21,17), verachtet (Ez 22,7)
verspottet (Prov 30,17) oder beraubt (Pro 19,26) werden. Das aber sind Vergehen,
die jede Autorität, sei es die des Gerichts, der Ältesten, der Beamten oder
schließlich die des Königs zerstören würden. Entsprechend ist dieses Gebot
auch als Sicherung der gesellschaftlichen Autoritäten außerhalb der Familie zu
interpretieren, die nur den Staat und die Herrschaftsordnung aufrechterhalten können,
wenn ihnen Achtung gezollt wird. Versagt man ihnen die Ehre, so muss der Staat
zusammenbrechen wie in der Exilzeit und mit ihm die Sicherheit der Familien und
der Einzelnen in ihr, so dass hierbei die angedrohte Konsequenz aus der
Nichtbefolgung des Gebotes gilt: das Leben wird verkürzt. Wie im Dekalog die
Autorität der Eltern zentral steht, so in dem deuteronomischen
Verfassungsentwurf, der analog aufgebaut ist, die Ämterverfassung, also die
Autorität des Staates. (25) „Ein Mann aber, der so vermessen ist, auf den Priester, der
dort steht, um vor dem Herrn, deinem Gott, Dienst zu tun, oder auf den Richter
nicht zu hören, dieser Mann soll sterben.“ (Dtr 17, 12) Die Achtung der gesellschaftlichen Autoritäten ist die
Grundlage des Zusammenlebens in antagonistischen Gesellschaften, deshalb hat der
Endredakteur des Dekalogs dieses Gebot an die zentrale Stelle gesetzt und zum
ersten der profanen Gebote gemacht.
Zurück zum Anfang
Das 6. Gebot:
„Du sollst nicht morden.“ (Ex 20,13)
„Morden“ bzw. „Töten“, wie man auch übersetzen
kann, heißt das ungesetzliche, willkürlich mit Gewalt vollzogene Töten eines
Menschen: von der fahrlässigen Tötung über den Totschlag bis zum Mord, bei
dem Absicht, niedere Beweggründe und Heimtücke involviert sind. Das Gebot
wendet sich auch gegen den Vollzug der Blutrache. Nicht einbezogen ist die
gerichtlich angeordnete Todesstrafe und der Krieg mit äußeren Feinden. Durch
die Verlagerung des Todesrechts von der Familie zur Ortsgerichtsbarkeit wird
nicht nur „die gemeinschaftszerstörende Wirkung der Bluttat“ beachtet,
sondern auch die Intention bewertet, so dass zwischen Totschlag und Mord
unterschieden werden kann. Das Prinzip der Erfolgshaftung wird durch die
Verschuldungshaftung abgelöst, damit konnte auch die Sanktionsgewalt eingeschränkt
werden. Das moralische Gebot jedoch bezieht sich gegenüber dem Recht auf alle Tötungsfälle.
„Im hebräischen Begriffsspektrum von ‚töten’ wird nicht zwischen vorsätzlicher
und unvorsätzlicher Tat geschieden, sondern auf die gemeinschaftszerstörende
Wirkung der Bluttat abgehoben. Der Prohibitiv des Dekalogs dient der
Verinnerlichung der Norm des Lebensschutzes in der Familie, so wie der
todesrechtliche Rechtssatz (Ex 21,12) die Bluttat in der gentilen
Rechtsgemeinschaft durch die Generalprävention der Todessanktion zu verhindern
sucht.“ (26) Der Zweck des Gebots
ist die elementare Lebenssicherung des Nächsten, auch über die Familie hinaus.
Es gilt selbstverständlich für Sklaven, schützt sie aber auch vor der Willkür
des Herrn, der sie nicht töten darf, obwohl die Strafe für den Herrn geringer
ist, wenn er einen Sklaven tötet als umgekehrt. Als moralisches Gebot gilt es für
alle Menschen, ist also universell. Alle Lebensgemeinschaften müssen
verhindern, dass ihre Mitglieder sich gegenseitig töten. Aber dafür ein
moralisches Gebot aufzustellen, setzt das Überhandnehmen von Morden voraus,
ebenso wie permanente Gründe in der Gesellschaft, die Einzelne zum Mord
animieren. Eine herrschaftlich verfasste Gesellschaft, die in Arm und Reich
gespalten ist, bietet ständig Anreize, selbst über Leichen zu gehen. Hinzu
kommt wohl noch der Streit um das Land zwischen den Zurückgebliebenen, meist
Arme, die sich das Land angeeignet hatten, und den Heimkehrern aus dem Exil, die
der Oberschicht angehörten und ihr früheres Land zurück haben wollten.
Zurück zum Anfang
Das 7. Gebot:
„Du sollst nicht die Ehe brechen.“ (Ex 20,14)
Die Sicherung der Genealogie und die Weitergabe des
Erblandes als materielle Existenzgrundlage der Familie sind die Zwecke der Ehe.
Die Verhinderung des Ehebruchs war also existenzwichtig für die Familie. Die
Familie ist patriarchalisch und das Erbrecht patrilinear. Bleibt die Ehe, die
immer exogam sein muss, kinderlos, dann kann der Mann eine zweite Frau nehmen.
„Der Landbesitz vermittelt den Zusammenhalt der Großfamilie. Löst man den
Zusammenhang einer Familie mit ihrem Boden auf, so ist ihr Zusammenhalt und
damit ihr Überleben in Frage gestellt. Die Polygamie soll auch den Zusammenhang
von Genealogie und Besitz im Erbrecht sichern.“ (27) Ehebruch bezieht sich also immer auf die verheiratete Frau.
Nach dem Recht werden beide Ehebrecher, Mann und verheiratete Frau mit dem Tode
bestraft. Die Beziehung eines Ehemannes mit einer Konkubine galt nicht als
Ehebruch. Auch die Geschlechtsbeziehung eines Mannes mit einer unverheirateten
Frau, die auch noch nicht inchoativ verheiratet ist, d.h., einem anderen Mann
noch nicht versprochen ist, galt nicht als Ehebruch, auch wenn der Mann
verheiratet ist. Entjungferte er sie, so musste er den Brautpreis bezahlen oder
sie heiraten. Dagegen ist jede Geschlechtsbeziehung einer Ehefrau mit einem
anderen Mann als den eigenen, ob verheiratet oder nicht, immer Ehebruch und hat
bei dessen Aufdeckung ihren Tod zur Folge. Der Grund für diese Unterscheidung
liegt ebenfalls in der Aufrechterhaltung der Familie. Eine Ehefrau, die ein Kind
von einem fremden Mann zur Welt bringt, gefährdet die Genealogie und damit das
Überleben der Großfamilie. Während ein uneheliches Kind, das der Ehemann
zeugt, nicht erbberechtigt ist, muss das Kind der Ehefrau als erbberechtigt
anerkannt werden, weil auch der Ehemann der Vater sein könnte. Das siebte Gebot
soll als moralischer Appell von vornherein diese Art Ehebruch verhindern, trägt
also ebenfalls zur Verinnerlichung der Rechtsnormen bei. Dieses Gebot ist am
weitesten gebunden an patriarchalische Agrargesellschaften.
Zurück zum Anfang
Das 8. Gebot:
„Du sollst nicht stehlen.“ (Ex 20,15)
Eine herrschaftlich verfasste Gesellschaft, die sich in
Arme und Reiche spaltet, muss dieses Gebot aufstellen. Denn der Besitz ist die
materielle Lebensgrundlage der Menschen und die Sphäre ihrer Freiheit. Stiehlt
jemand relevante Teile, dann ist die Existenz der Bestohlenen gefährdet. Die
Verführung zum Diebstahl ist je größer, je gelockerte die Sitten sind und je
weiter die Kluft zwischen den Schichten sich öffnet. Das Gebot ist allgemein
formuliert, es gilt für alle Menschen, ob freier Vollbürger, personae
miserio oder Sklaven. Trotz dieser universellen Geltung hat Crüsemann die
Zehn Gebote als „Standesmoral“ bewertet. „Der Dekalog gilt erwachsenen Männern,
die rechts- und kultfähig sind. Sie sind charakterisiert durch Land- und
Viehbesitz, also sind es Bauern; sie besitzen Sklaven, also sind es Freie. (...)
Der Dekalog gilt also nicht (wie vielfach bei uns) Kindern; er gilt nicht (wie
selbstverständlich bei uns) Frauen; er gilt nicht Sklaven; er gilt nicht
Lohnarbeitern. Er ist damit zunächst nur für die Männer eines bestimmten
Standes in Israel formuliert worden.“ (28)
Da sich die Verteilungskämpfe um Land und Reichtum, die sozialen
Differenzierungsprozesse in arme Kleinbauern und reiche Großgrundbesitzer in
dem Stand der freien Vollbürger abspielten, habe der Dekalog die Aufgabe, jeden
denkbaren Griff nach den Lebensgrundlagen und der Freiheit dieses Standes und
damit des gesamten Staates, dessen Träger dieser Stand ist, zu verhindern.
Dagegen wendet Otto ein, dass aufgrund der neuartigen Theologie (Bilderverbot,
Sabbat) der Dekalog nicht aus dem 8. Jahrhundert stammt, wie Crüsemann
unterstellt, sondern aus der Exilzeit (6. Jh. v.u.Z.). Er sei Teil eines
Entwurfs für das neue Israel nach der Exilzeit, in der eine Gesellschaft ohne
marginale Gruppen gefordert wurde. Der Dekalog gelte also universal und sei
keine „Klassenethik“ (29). Wie
immer die Frage um die Entstehungszeit philologisch und theologisch gelöst wird
- ich halte Ottos Argumente für stichhaltiger -, das universell formulierte
Gebot „Du sollst nicht stehlen“ ist dennoch Ausdruck einer
herrschaftssichernden Moral: Es schützt nicht nur den Mantel des Einzelnen oder
das Essen, das er gerade in den Mund stecken will. Indem das achte Gebot vor
Diebstahl schützen will, also den Besitz bewahren soll, rechtfertigt und
sichert es auch eine Ordnung, in der es Reiche und Arme, Herren und Knechte,
Sklavenhalter und Sklaven gibt. Wenn ein Sklave oder Tagelöhner mehr
produziert, als er an Lebensmitteln zurückbekommt, also für seinen Herren ein
Mehrprodukt schafft, dann sichert dieses Gebot auch eine Ordnung ab, in der jene
Aneignung des Mehrprodukts ohne Gegenleistung erfolgt, es sichert also Diebstahl
an Arbeit der Sklaven und Tagelöhner ab. Dadurch aber widerspricht sich das
Gebot selbst. Damit dieser Widerspruch zum Bewusstsein kommt, muss die
kostenlose Aneignung des Mehrprodukts für die damaligen Menschen offensichtlich
sein. Das war der Fall beim Zinsnehmen, bei dem der Geldverleiher mehr zurück
erhielt als er vorgeschossen hatte. Das Zinsnehmen wurde tatsächlich als
Diebstahl oder unmoralische Bereicherung erkannt (im Gegensatz zu heutigen
Ideologen) und dem entsprechend ein Zinsverbot ausgesprochen: „Du sollst
deinem Bruder keinen Zins auferlegen, weder Zins für Geld, noch Zins für
Nahrungsmittel, noch Zins für irgend etwas, was man gegen Zins verleiht.“ (Dtn
23,20) Dass dieses Gebot den
Interessen autarker Subsistenzbauern entsprach, dass der ökonomische
Fortschritt herrschaftlich verfasster Gesellschaften bald über dieses soziale
Gebot hinwegging, es wahrscheinlich nie durchsetzbar war, ändert nichts an
seiner moralischen Wahrheit. Dass allerdings Lohn- und Sklavenarbeit ein
Mehrprodukt abwirft und deshalb wie Diebstahl ist, wird verschleiert durch das
Geben von Leistung (Arbeit) und (wenn auch geringerer) Gegenleistung (z.B.
Nahrung).
Zurück zum Anfang
Das 9. Gebot:
„Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten
aussagen.“ (Ex 20,16)
Das Gebot bedeutet in dieser Allgemeinheit, keine Lüge über
andere zu verbreiten, weil jede Lüge die Kommunikation und damit das
arbeitsteilige Zusammenleben bedroht. In ursprünglicher und engerer Bedeutung
war es aber auf den Gerichtsprozess bezogen. Der Hauptbeweis im
Gerichtsverfahren war der Zeugenbeweis. Mit ihm steht und fällt die
Gerichtspraxis. Das neunte Gebot soll diese Gerichtspraxis absichern. Dass es in
dem Dekalog aufgenommen wurde, ja das es sogar zwei Gebote dieser Art gibt (vgl.
3. Gebot), zeigt den Grad der Korruption im Gerichtsverfahren an. Es war gängige
Praxis, Richter und Zeugen zu bestechen. Damit wurden die Gerichtsverfahren ein
wichtiges Mittel vieler Großgrundbesitzer, sich Sondervorteile zu verschaffen,
den Kleinbauern von seinem Land zu vertreiben oder gar in die
Schuldknechtschaft zu zwingen. Zugleich lag es im wohlverstandenen
Eigeninteresse der Oberschicht als Ganzer, diese Rechtsbeugung zu unterbinden,
weil nicht nur der Rechtsfriede zerstört wurde und damit der Zusammenhalt der
Gesellschaft, der ihre Machtgrundlage war, sondern auch durch die Enteignung der
Kleinbauern die soziale Basis der Herrschaft abzubröckeln begann.
Zurück zum Anfang
Das 10. Gebot:
„Du sollst nicht nach dem Haus deines Nächsten
verlangen. Du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen, nach seinem
Sklaven oder seiner Sklavin, nach seinem Rind oder seinem Esel oder nach irgend
etwas, das deinem Nächsten gehört.“ (Ex 20,17)
Das hebräische Wort, das hier mit „verlangen“ übersetzt
wurde, hat eine vielfältigere Bedeutung als „begehren“ oder
„verlangen“. Sie reicht von dem inneren Begehren über das Besitzenwollen
bis zur Ausführung der Besitzergreifung. Da es aber auch das Begehren einschließt,
wird im zehnten Gebot ausdrücklich auf eine Verinnerlichung der Normen des
Zusammenlebens abgezielt. Das Ausgreifen auf die innere Einstellung des Menschen
verdeutlicht auch den Übergang vom justitiablen Verbot zum moralischen Appell.
(30) Der Zweck des Gebotes besteht
darin, allgemein den Lebensbereich des Nächsten zu schützen, d.h. vor allem
den Schutz des Schwächeren vor dem ökonomisch Stärkeren. In der
altisraelischen Gesellschaft gab es durchaus legale Möglichkeiten, den Anderen
um seinen Besitz zu bringen. „Da ist etwa die Möglichkeit, herrenloses Gut an
sich zu bringen und Frauen abwesender Männer - ein Problem besonders von
Kriegszeiten (...) Da sind aber
weitere Möglichkeiten, die harmlos mit der Geldleihe beginnen und in der Übernahme
des Besitzes enden. Schon das Bundesbuch warnt davor, Geld mit der Absicht zu
verleihen, Zugriffsrechte auf Personen des Nächsten zu bekommen.“ (31)
Reicht das Recht aber nicht aus, um den Nächsten zu schützen, dann versuchen
es die Priester und Propheten, also die Redakteure des Dekalogs, mit moralischen
Appellen und deren Verinnerlichung. Denn eine weitere Polarisierung der
Gesellschaft musste die soziale Krise verschärfen, die zumindest einer der Gründe
für den Untergang des jüdischen Staates war.
Die Aufzählung einzelner Objekte, die man nicht begehren
soll, wird am Schluss des Gebotes universalisiert zu „irgend etwas, das deinen
Nächsten gehört“. Die praktischen Gebote, die Mord, Ehebruch, Diebstahl
sowie auch die Mittel dazu, das Lügenzeugnis, verhindern sollen, werden in
diesem Gebot begründet. Es geht um den Schutz des Nächsten und damit des
Zusammenlebens in der sozial differenzierten Gesellschaft. Der diese Gebote einhält,
erkennt auch die Autorität der Eltern an, die Träger der Tradierung von Recht
und Moral sind. Und schließlich ist die Respektierung der Sphäre des Nächsetn
Anerkennung Gottes, dem diese Gebote zu verdanken sind. Derart verstanden ist
das zehnte Gebot das praktische Prinzip aller anderen Gebote, es fasst die
Verinnerlichung, Universalisierung und den praktischen Zweck aller anderen
Gebote zusammen.
Zurück zum Anfang
5.
Die Aporien der Dekalogsmoral
Der Dekalog insgesamt enthält die wichtigsten moralischen
Existenzbedingungen der herrschaftlich verfassten altisraelitischen Gesellschaft
sowie ihre theologische Absicherung. Die Entstehung der Moral nach dem Alten
Testament hat gezeigt, eine sozialdifferenzierte Gesellschaft auf einem gewissen
geistigen - hier theologischem – Niveau kann nicht mehr auf Moral verzichten.
Das belegt auch die Entstehung der Moral in Ägypten (etwas früher)
und Griechenland oder völlig unabhängig davon in China, die historisch
etwa zur gleichen Zeit erfolgt. „Daß in einer Gesellschaft der Durchbruch zu
‚postkonventionellem’ Denken erfolgen kann, setzt nicht nur eine Hochkultur
mit Staat, Schrift, hochgradiger Arbeitsteilung und Bildung voraus, sondern auch
ein Reifestadium, in dem sich traditionell bewährte, eingeübte Methoden der
Steuerung und Integration als nicht mehr hinreichend erweisen. Ohne eine
Herausforderung durch krisenhafte Entwicklungen entsteht keine Nachfrage nach
neuen Ordnungsmodellen; ohne eine hochentwickelte Kultur stehen nicht die Mittel
zur Verfügung, sie zu erarbeiten.“ (32)
„Die chinesische Moralphilosophie im allgemeinen wie der Konfuzianismus
und das Programm seines Begründers im besonderen sind nur zu verstehen, wenn
man die Fragen der Zeit kennt, auf die eine Antwort gefunden werden soll. Die
Herausforderung, der die chinesischen Philosophen sich stellen, ja, an der sich
das philosophische Denken als ein systematisches Hinterfragen überhaupt erst
entzündet, ist die Krise der konventionellen Sittlichkeit des alten China.“
(33) Diese allgemeine Entwicklung zu einer reflektierten Moral
differiert nach den geographischen und sozialen Umständen, in denen Menschen
sie hervorbringen. Die ökonomisch mehr oder weniger autarken Familien
Altisraels können nicht nur durch staatlichen Zwang wie angedrohte Strafen
zusammengehalten werden. Wenn die soziale Differenzierung zur Krise sich
steigert, ist auch die Reflexion und Verinnerlichung von Normen nötig, die z.T.
auf möglicher Einsicht, z.T. auf religiöser Absicherung basiert. Besonders das
zehnte Gebot, das auf die Verinnerlichung insistiert, ermöglicht allererst
selbständiges Handeln (unabhängig von der Sippe) und Eigenverantwortung für
sein Tun. Durch die in der
Moralreflexion und ihrer theologischen Absicherung betriebene Rationalisierung,
die zu einer durchdachteren (wenn auch hier noch mythologischen) Moral führt
gegenüber der Weisheitsmoral, wird auch die Herrschaft unter rationalere
Kriterien gestellt. Die Moral befördert die Verantwortung des Einzelnen, dessen
Verselbständigung durch die historische Entwicklung provoziert wurde. Er kann
dadurch zu ersten Ansätzen autonomen Handelns gelangen, ohne wirklich autonom
werden zu können. Dieser Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit ist durch das
Verhaftetsein in der Mythologie noch eng beschränkt, da die menschliche
Vernunft sich noch als fremde erfährt, sich in einem Gott personifizieren muss.
An dem Dekalog lässt sich die Aporie jeder Moral
aufzeigen, die Herrschaft absichern will. Moral ist Resultat sozialer Krisen,
sie soll auf die Gesellschaft einwirken, um die Krise zu bewältigen. Dadurch
aber sichert sie eine Gesellschaft ab, deren innere Dynamik ständig wieder zur
Krise treibt, wie z.B. in Israel und in der gesamten Antike die
Bodenkonzentration (oder heute die Kapitalakkumulation). Wird die Moral von
einer bloßen Standesmoral (was auch für die Weisheitsmoral nicht ganz
zutrifft) zu einer universalen, dann enthält sie auch Momente, die über die
Absicherung von Herrschaftsverhältnissen hinausgehen, wie z.B. die Universalität
der Gebote oder die Nächstenliebe. Indem universale Moralprinzipien jedoch den
Zweck haben, soziale Krisen stillzustellen, ohne die institutionalisierte
Herrschaft selbst, die solche Krisen verursacht, der Kritik zu unterziehen, befördert
sie gerade die Verhältnisse, die ihrem rationalen Gehalt entgegenstehen. So ermöglicht
der Schutz des Nächsten, auf den die praktischen Gebote des Dekalogs abzielen,
nicht nur dem Prinzip nach einen friedlicheren Umgang miteinander; dieser Schutz
bewahrt auch eine Ordnung, zu der wesentlich der Kampf ums Mehrprodukt gehört.
(34) Dies Aporie der
gesellschaftlichen Wirkung von Herrschaft affirmierender Moral muss sich auch
immanent in der Konstruktion der Moralvorstellungen zeigen.
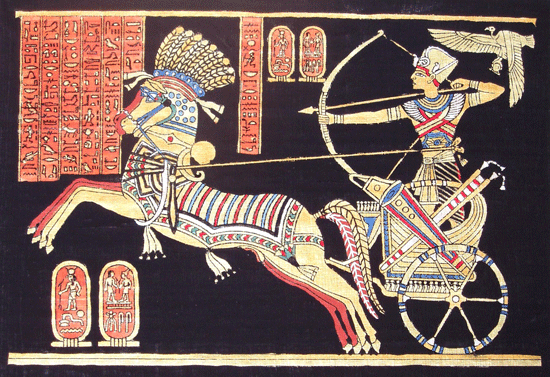
Moral dient der Reduktion der Gewalt und stabilisiert
dadurch eine Herrschaftsordnung, die immer wieder Gewalt erzeugt.
Gott als Geber und Legitimator der Gebote soll verhindern,
dass ein Auseinanderbrechen von Tat und Ergehen für den einzelnen zum Grund
wird, die Gebote zu missachten. Sie sind metaphysisch begründet und dadurch
unangreifbar durch eine ihr nicht entsprechende empirische Erfahrung. Die
Hioberzählung zeigt aber, dass sie dann auch nicht mehr vermittelbar sind, wenn
das tatsächliche Leben völlig von ihnen abweicht. Sollen sie nicht bloß der
Heiligenschein einer unheiligen Wirklichkeit sein, dann muss es zwischen dem sündigen
Leben und den göttlichen Geboten eine Vermittlung geben. Diese theologische
Vermittlung sollte der Sühnegedanken leisten, der auf Gottes Gnade beruht.
„Die von Gott dem Menschen gnädig eröffnete Möglichkeit der
stellvertretenden Sühne unterbricht den Zusammenhang von Tat und Ergehen und
gibt dem sündigen Menschen die Möglichkeit weiterzuleben.“ (35)
Die größere Verantwortung des Einzelnen impliziert auch die Chance der
Reue und Läuterung, weil er fehlbares Subjekt ist und nicht nur Teil einer
objektiven Allgemeinheit. „Wenn der Schuldige sich von allen Sünden, die er
getan hat, abwendet, auf alle meine Gesetze achtet und nach Recht und
Gerechtigkeit handelt, dann wird er bestimmt am Leben bleiben und nicht
sterben“ (Ez 18,21). Doch dieser
Gedanke ist ein fauler Kompromiss: er eröffnet jeder Heuchelei Tür und Tor. Da
in der Praxis nur Menschen den Sühneerlass geben können, wird es möglich,
unmoralisch zu handeln und doch die Gebote verbal anzuerkennen. (Man belud mit
seinen aufgeschriebenen Sünden einen Sündenbock, der dann exemplarisch
bestraft wurde, indem er in die Wüste gejagt wurde.) Auch theologisch ist der Sühne-
und Gnadengedanke aporetisch. „Das Ziel theologischer Normenlegitimation wird
in Frage gestellt, wenn nicht vom Tun des Menschen, sondern unabhängig davon an
die Sühneinstitution das Überleben des Menschen gebunden wird. Die
Differenzierung zwischen läßlichen Sünden, die gesühnt werden können, und
unsühnbaren Kapitalverbrechen will dieser Problematik entgehen, doch ist damit
nur erreicht, daß der Heilswille Gottes durch das Tun des Menschen eingeschränkt
wird und umgekehrt der Zustand von Tat und Ergehen und damit der zwischen Übeltat
und Strafe, Ethos und gelingendem Leben teilweise außer Kraft gesetzt wird.“
(36) Damit die Aporie zwischen göttlicher
Forderung nach Unbedingtheit der Gebote und göttlicher Gnade, die diese
Unbedingtheit teilweise aufhebt, nicht geradezu unmoralisches oder illegales
Handeln animiert (man denken nur an den mittelalterlichen Ablasshandel), soll
die Furcht vor Gottes Fluch den Ernst der Gehorsamsforderung einschärfen. Der
Endredakteur des Dekalogs lässt seine literarische Figur Moses bei der Übergabe
der Gebote an das Volk mit Gott drohen, um die heteronome Moral abzusichern:
„Die Furcht vor ihm soll über euch kommen, damit ihr nicht sündigt.“ (Ex
20,20) Wer oder was Gott ist, wird
von den Propheten und Priestern den Menschen vorgegeben. Sie können ihn nur
behaupten, nicht beweisen, weil dafür die rationalen Möglichkeiten fehlen.
Warum man Jhwh und nicht Baal anbeten sollte, dafür standen allein die
Tradition und die Autorität von Staat und Priesterschaft. Diese waren den
Menschen aber nicht erst durch die Exilzeit problematisch geworden.
Interpretiert man Gott als Ausdruck menschlicher Vernunft, die zwar in einem
fremden Wesen personifiziert ist, das aber doch Vernunft verkörpert, dann muss
sich die Wahrheit in der Praxis zeigen. In dem mit dem Dekalog verwandten
Deuteronomium lässt der Schreiber Gott sagen: „Einen Mann aber, der nicht auf
meine Worte hört, die der Prophet in meinem Namen verkünden wird, ziehe ich
selbst zur Rechenschaft.“ (Dtn 18,19) Damit
aber kein falscher Prophet kommt, muss er zugleich warnen: „Und wenn du
denkst: Woran können wir ein Wort erkennen, das der Herr nicht gesprochen hat?,
dann sollst du wissen: Wenn ein Prophet im Namen des Herrn spricht und sein Wort
sich nicht erfüllt und nicht eintrifft, dann ist es ein Wort, das nicht der
Herr gesprochen hat. Der Prophet hat sich nur angemaßt, es zu sprechen. Du
sollst dich dadurch nicht aus der Fassung bringen lassen.“ (Ex 18,21 f.)
Zur Praxis der herrschaftlich verfassten Gesellschaft gehört allerdings
regelmäßig die Kluft zwischen Tat und Ergehen: gute Taten bringen oft
Nachteile im Leben, böse Taten oft Erfolge und Wohlergehen. Die heteronome
Moral des Dekalogs, die der Prophet verkündet, musste
an der Praxis scheitern, und die Leute bräuchten sich wegen dieser
Gebote „nicht aus der Fassung bringen lassen“. Damit dies nicht geschieht,
da die Gesellschaft eine Moral benötigt, muss sie durch das Mittel abgesichert
werden, das sie einschränken wollte - die Gewalt. Will man moralische
Prinzipien als bindend propagieren, obwohl sie heteronom und daher letztlich
nicht einsichtig zu machen sind, dann bleibt nur die objektive Seite der Furcht
- der wirkliche Terror. Als Moses vom Berg Gottes
mit den zehn Geboten kommt und sieht, dass sein Volk um das goldenen Kalb
tanzt, also das erste Gebot, die Grundlage aller anderen Gebote, gebrochen hat,
befiehlt er seinem Stamm: „So spricht der Herr, der Gott Israels: Jeder lege
sein Schwert an. Zieht durch das Lager von Tor zu Tor! Jeder erschlage seinen
Bruder, seinen Freund, seinen Nächsten. Die Leviten taten, was Mose gesagt
hatte. Vom Volk fielen an jenem Tag gegen dreitausend Mann.“ (Ex 32, 27 f.)
Zurück zum Anfang
1) Historisches
Wörterbuch der Philosophie, Bd. 6, S. 149 f.
2) Zitiert
nach W. F. Sybkowjez, S 13. Wenn Sybkowjez dann allerdings schriebt: „Das
bemerkenswerte Phänomen der tasmanischen Sprache unterstützt die Vermutung, daß
moralische Bewertungen von Menschen offensichtlich als eine der ältesten
Schichten begrifflichen Denkens auftreten“, dann hat er einen weiteren Begriff
von Moral als ich, d.h. er schließt auch das ein, was ich „sittlich“ nenne.
3) Ebda.; vgl.
auch Leakey/Lewin, S. 297.
4)
A.a.O., S. 65.
5)
A.a.O., S. 69.
6) Aristoteles:
Metaphysik, 981 b. Zur Moralentstehung bei den Ägyptern vgl. das Buch von Otto:
Theologische Ethik, passim.
7) Fohrer:
Geschichte Israels, S. 73.
8) Bibellexikon,
S. 166.
9) Alle
folgenden Zitate der Weisheitsmoral, wenn nicht anders gekennzeichnet, nach der
Übersetzung von Otto: Theologische Ethik, S. 153 ff. Ansonsten wird nach der
Einheitsübersetzung zitiert.
10)
A.a.O., S. 160.
11) Die folgenden sich widersprechenden Sätze sind nach
der Einheitsübersetzung wiedergegeben.
12)
A.a.O., S. 105. Der Begriff des „Rentenkapitalismus“ ist
anachronistisch für die gesamte Antike, weil es weder Kapital noch Kapitalismus
gab. Gemeint ist die Existenz der städtischen Oberschicht als Rentner ihrer
Landgüter. Ein Rentnerdasein aber widersprach der Vorstellung eines
Zusammenhangs von Tun und Ergehen, die für die Weisheitsmoral galt.
13)
Bibellexikon, S. 166.
14) Vgl. Otto,
S. 22.
15) Bibellexikon, S. 105.
16) Crüsemann: Bewahrung der Freiheit, S. 8 ff.
17)
A.a.O., S. 37.
18) Vgl. Otto,
a.a.O., S. 217.
19) A.a.O., S. 69 f. und 218.
20) Von „herrschender Klasse“ in vorkapitalistischen
Gesellschaften zu sprechen, wäre falsch, weil dieser Begriff rein ökonomisch
bestimmt ist. Ihn auf die gesamte Geschichte anzuwenden, wäre anachronistisch,
denn in vorkapitalistischen Gesellschaften waren soziale Gruppen niemals nur ökonomisch
bestimmt, sondern immer auch durch Geburt, Privilegien und institutionelles
Ansehen von anderen Bevölkerungsgruppen unterschieden.
21) Crüsemann, a.a.O., S. 58.
22) Otto, a.a.O., S. 244, Übersetzung der Zitate nach
Otto.
23) Otto,
a.a.O.
24) Crüsemann, a.a.O., 59 f.
25) Vgl. Otto,
a.a.O., S. 33 f.
26) Otto,
a.a.O., S. 36.
27)
A.a.O., S. 50.
28) Crüsemann, a.a.O., S. 28 f.
29) Otto,
a.a.O., S. 214.
30)
A.a.O., S. 213.
31) Crüsemann, a.a.O., S. 77.
32) Roetz: Chinesische Ethik, S. 59.
33)
A.a.O., S. 67.
34) Auch wenn solch eine Kritik in der Antike nur
sporadisch geäußert wurde, nicht aber wirksam werden konnte, weil an der
Herrschaft der kulturelle Fortschritt hing, ist sie doch in Bezug auf die
Gegenwart relevant, weil heute auch ein kultureller Fortschritt ohne Herrschaft
real möglich ist.
35) Otto,
a.a.O., S. 266.
36) Ebda.
Zurück zum
Anfang
Aristoteles: Metaphysik. In der Übersetzung von Hermann
Bonitz. Neu bearbeitet, mit Einleitung und Kommentar herausgegeben von Horst
Seidl, Hamburg 1978 (2 Bde.).
Alte Testament, in: Die Bibel. Einheitsübersetzung. Altes
und Neues Testament, Stuttgart 1980.
Assmann,
Jan: Ma’at. Gerechtigkeit und Unsterblichkeit im Alten Ägypten, München
1995.
Bibellexikon. Hrsg. V. Klaus Kooch, Eckhart Otto, Jürgen
Roloff und Hans Schmoldt, 4. Auflage, Stuttgart 1987.
Crüsemann, Frank: Bewahrung der Freiheit. Das Thema des
Dekalogs in sozialgeschichtlicher Perspektive, Güterslohe 1993.
Fohrer: Geschichte Israels
Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 6, Darmstadt
1984.
Leakey/Lewin: Der Ursprung des Menschen. Aus dem
Amerikanischen von Sebastian Vogel, Ffm. 1993.
Neue Jerusalemer Bibel. Einheitsübersetzung. Mit dem
Kommentar der Jerusalemer Bibel. Neu bearbeitete und erweiterte Ausgabe. Deutsch
herausgegeben von Alfons Deissler und Anton Vögtle in Verbindung mit Johannes
M. Nützel, Frankfurt am Main, Wien 1990.
Otto, Eckhart: Theologische Ethik des Alten Testaments,
Stuttgart, Berlin, Köln 1994.
(In weiten Teilen folge ich Otto in seinen theologischen
Reflexionen – ohne immer seine Wertungen zu übernehmen.)
Roetz, Heiner: Die chinesische Ethik der Achsenzeit, Ffm.
1992.
Sybkowjez, W.F.: Vom Ursprung der Moral, Berlin 1978.

Aborigines auf dem
Kriegspfad gegen Zerstörer der Sitte
Zurück zum Anfang

Wenn
Sie uns Ihren Kommentar schreiben wollen,
können
Sie dies über unser:
| | Unsere Internetpräsens
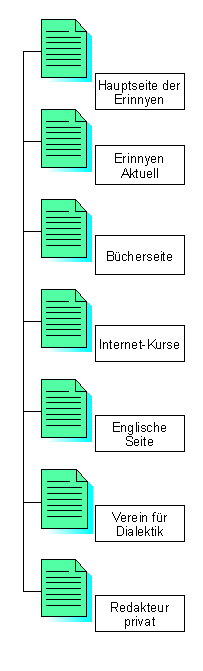



u.a.

Die Erinnyen Nr. 16 sind erschienen.
|